Texte & Reden
Aus: Común. Magazin für stadtpolitische Interventionen, Nr. 8, vom 24.11.2023
https://comun-magazin.org/category/comun-8/
Stadtteilbeiräte – ein Modell der Bürger:innenbeteiligung?
Wie sich die Hamburger Sanierungsbeiräten der 1970er Jahre als Quartiers- und Stadtteilbeiräte zu einem umkämpften Korrektiv der Politik entwickelten
von Michael Joho
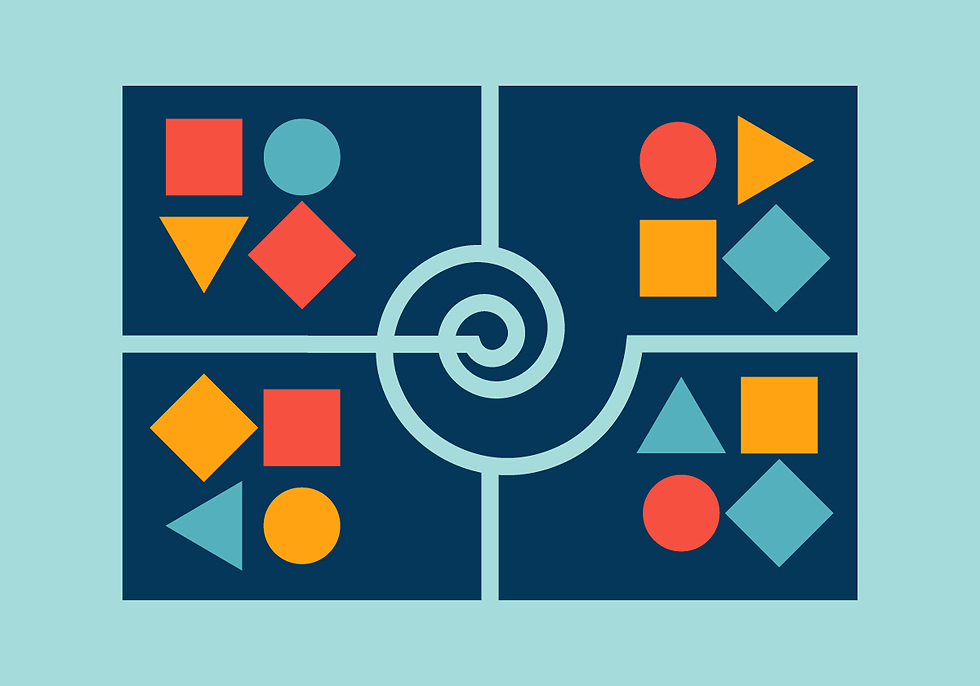
Vor einem Jahr hätte ich noch uneingeschränkt für Stadtteilbeiräte als ein Beteiligungsmodell von unten plädiert. Aufgrund der faktischen Auflösung des Stadtteilbeirats St. Georg durch den zuständigen Bezirk Hamburg-Mitte – genauer die dort regierende konservative »Deutschlandkoalition« aus SPD, CDU und FDP – bin ich ernüchtert. Im Zweifelsfall würgt die etablierte Politik einen allzu kritischen Beirat einfach ab, auch wenn er der älteste Hamburgs (seit 1979) und zudem der bestbesuchte (mit bisweilen 100 Teilnehmer:innen) war. Aber fangen wir vorne an.
Vor dem Hintergrund einer in Bewegung geratenen Gesellschaft ab Mitte der sechziger Jahre und der Brandt‘schen Formel „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ entwickelten sich in den siebziger Jahren allenthalben Bürgerinitiativen, mal gegen Flughafenlärm, mal gegen Fahrpreiserhöhungen, aber immer nur als Ein-Punkt-Initiativen. Mit dem 1971 verabschiedeten Städtebauförderungsgesetz wurde dem gnadenlosen Abriss von Altbauquartieren entgegengewirkt, stattdessen gab es nun Sanierungsgebiete, für die erstmals auch ein gewisses Maß an Bürger:innenbeteiligung vorgeschrieben war. So entstanden Sanierungsbeiräte, der erste in Hamburg Ende 1979 in meinem Stadtteil St. Georg. Sie ermöglichten über die beteiligten Gruppen – Anwohner:innen, Gewerbetreibende, Mieter:innen, Grundeigentümer:innen usw. – erstmals eine regelmäßige Mitsprache bei allen das jeweilige Gebiet betreffenden Fragen.
Vom Sanierungsbeirat zum Stadtteilbeirat
Nehmen wir das Beispiel des Beirats im Hamburger Hauptbahnhofviertel St. Georg. Fast von Anfang an verstand er sich nicht nur als Sprachrohr für das engere Sanierungsgebiet »Lange Reihe S1«, sondern er nahm sich, sehr zum Ärger der Kommunalpolitik, heraus, vielerlei Anliegen des gesamten Stadtteils zu thematisieren. Als es Ende 1989 hieß, die Sanierung im Gebiet S1 liefe bald aus und auf einer Jubiläumsveranstaltung verkündet werden sollte, dass damit auch der Sanierungsbeirat seine Aufgaben erfüllt hätte, regte sich massiver Protest. Rund 300 St. Georger:innen rangen dem SPD-Vertreter die Zusage einer neuen Beteiligungsstruktur ab, wenn es denn schon keinen Sanierungsbeirat mehr geben würde. Das war damals die Geburtsstunde eines am Bezirk Hamburg-Mitte angedockten Stadtteilbeirats, zugleich aber auch des Gedankens, dass eine einmal institutionalisierte Bürger:innenbeteiligung nicht einfach deswegen endet, weil irgendein Programm ausläuft. Aufrechterhalten wurde die Finanzierung des Gremiums über viele weitere Jahre dadurch, dass St. Georg immer wieder in ein neues Förderprogramm rutschte. 2015 sollte damit allerdings endgültig Schluss sein, da der Stadtteil definitiv aus der letzten Förderung durch das „Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE) herausfiel. 2014 wurde die Zahl der jährlichen Sitzungen von zehn auf fünf reduziert, ab 2015 sollte dann jegliche Unterstützung durch die Bezirksverwaltung ausbleiben, sowohl hinsichtlich der Finanzierung, Protokollführung und Moderation als auch überhaupt der Teilnahme von Vertreter:innen der Bezirksverwaltung. Die SPD Hamburg-Mitte prägte damals das Unwort von „selbsttragenden Strukturen“ des zukünftigen Beirats, also von selbst organisierten Sitzungen ohne finanzielle Unterstützung und ohne regelhafte Beteiligung von Bezirksamt und -politik. Der Widerstand gegen diesen erneuten Versuch der Auflösung des Gremiums war erfolgreich und führte in Hamburg dazu, dass inzwischen die meisten Beiräte auch nach Auslaufen der RISE-Förderung fortgeführt wurden. Dafür muss allerdings alljährlich ein Antrag gestellt und von der in den sieben Hamburger Bezirken regierenden Koalition angenommen werden, um entsprechende Mittel in der Höhe von einigen tausend bis 15.000 Euro pro Beirat aus dem Quartiersfonds zu generieren. Von einer planbaren, gar dauerhaften finanziellen Förderung und einer rechtlichen Absicherung war und ist das weit entfernt.
50 Gremien, die sich regelmäßig, meist im Ein- oder Zweimonatsrhythmus, treffen und an die 1.000 Stadtteilaktive zusammenführen. Es gibt nichts Vergleichbares in Hamburg, keine andere Beteiligungsform bringt über Jahre, teilweise über Jahrzehnte, so viele Menschen zusammen, wie eben die Beiräte.
Immerhin, es gibt sie also, diese Quartiers- und Stadtteilbeiräte, und das in rund 50 Gebieten, die irgendwann einmal in das eine oder andere Förderprogramm aufgenommen wurden oder noch darin stecken. 50 Gremien, die sich regelmäßig, meist im Ein- oder Zweimonatsrhythmus, treffen und an die 1.000 Stadtteilaktive zusammenführen. Es gibt nichts Vergleichbares in Hamburg, keine andere Beteiligungsform bringt über Jahre, teilweise über Jahrzehnte, so viele Menschen zusammen, wie eben die Beiräte. Das übersteigt in dieser Kontinuität jedes einzelne Beteiligungsverfahren zu einem bestimmten Anliegen. Bei den betreffenden Quartieren handelt es sich zu einem Gutteil um solche, die nicht gerade verwöhnt sind von der öffentlichen Wahrnehmung, die vielmehr mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sind.
Zumeist ist es ein Stamm von Beiratsteilnehmenden, der als Team von Expert:innen des Quartiers zusammenkommt und oftmals die zentrale Säule der Stadtteildemokratie darstellt. Anlassbezogen kommen oft weitere Interessierte dazu, wenn irgendein konkretes Problem auftritt oder für eine bestimmte Forderung mobilisiert wird. Die Palette der behandelten Themen ist breit und vorrangig von den spezifischen Verhältnissen des Quartiers abhängig. Es gibt aber selbstverständlich auch übergreifende, viele Menschen und Viertel gleichermaßen berührende Entwicklungen, zum Beispiel wenn es um die Wohnungspolitik oder die Klimakatastrophe geht. Den Austausch darüber organisiert das 2009 gegründete »Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte«. Etwa im sechswöchigen Turnus lädt ein Lenkungskreis zu einer informellen Zusammenkunft ein, um über aktuelle Themen der Stadt(teile) und die Situation der Beiräte zu diskutieren. Rund die Hälfte der hamburgischen Beiratsgremien sind hier eingebunden. Richtungsweisend war eine Tagung des Netzwerks Ende April 2013 mit weit über 100 Teilnehmer:innen. Der Titel des Aktionstages machte klar, welchen Stellenwert sich die Stadtteilrecken selber zumessen: „Nur mit uns!“.

Demonstration für den Erhalt des Stadtteilbeirats St. Georg Ende März 2014 | Foto: © Michael Joho
St. Georg tickt anders
Noch einmal zurück zum Stadtteilbeirat St. Georg, der sich in den vergangenen Jahren zu einem zumindest vom Selbstverständnis her autonomen Gremium gemausert hatte. Selbstbewusst stellte er auf jeder der verknappten Sitzungen Anträge, forderte Maßnahmen gegen die Verdrängung der Wohnungs- und „kleinen“ Gewerbemieter:innen ein, protestierte gegen überbordende Hotels, Eigentumswohnungen und die Vertreibung der Obdachlosen, hatte aber ebenso die „kleineren“ Themen parat, wie zum Beispiel die Einbenennung eines Weges nach Inge Stolten (als einer von drei Frauennamen gegenüber 31 Ortsbezeichnungen mit männlichem Namen) oder die Wiederinbetriebnahme einer Solaruhr auf einem Platz an der Langen Reihe. Genau das war jahrzehntelang das Salz in der Suppe: Stadtteilmeinung zu fokussieren, organisierte Beteiligungsstrukturen zu nutzen, in die auch Verwaltung und Politik einbezogen sind und die regelmäßig stadtteilbezogene Informationen liefern, Rede und Antwort einfordern und Anträge formulieren, auf die die Bezirkspolitik reagieren muss. Und genau das wurde für die etablierte Bezirkspolitik und -verwaltung in den vergangenen Jahren zu einer nervenden Herausforderung, weil der Beirat dem Bezirk mit seinen Beschlüssen Arbeit machte und die Bezirksgranden aus SPD, CDU und FDP unter Druck setzte. Nun muss mensch wissen, dass das Szeneviertel St. Georg anders tickt als der Bezirk Mitte, in dem es liegt: Bei den letzten Wahlen zu den sieben Bezirksversammlungen im Mai 2019 kamen in St. Georg die GRÜNEN auf 39,6 % und die LINKE auf 16,1 %, also auf weit mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Im Bezirk Mitte erhielt die SPD gerade mal 20,9 %, die CDU 11,6 % und die FDP 6,5 % – und erst durch den Übertritt von sechs grünen Mandatsträger:innen zur SPD konnte diese überhaupt erst eine Bezirkskoalition auf die Beine stellen. Hier gibt es also ein deutliches Gefälle. Seine vordemokratische Haltung zu diesem Gefälle brachte der Bürgerschaftsabgeordnete und örtliche Bürgervereinsvorsitzende Markus Schreiber (SPD) auf den Punkt, als er im Juli 2022 meinte, der Beirat solle gefälligst die Mehrheit in der Bezirksversammlung akzeptieren und diese mit seinen Forderungen nicht immer wieder infrage stellen (▷ Zeitung des Bürgervereins zum Thema Stadtteilbeirat). Merke: Partizipation in einem Stadtteil hat sich nach diesem Verständnis an den Mehrheitsbeschlüssen auf Bezirksebene zu orientieren – und mehr nicht.
Das ist sicherlich der Kernpunkt, der die »Deutschlandkoalition« am 31. Januar 2023 dazu bewogen hat, den Stadtteilbeirat St. Georg de facto aufzulösen und bis zu seiner „Neuausrichtung“ alle bereits vereinbarten fünf Sitzungstermine zu canceln. Seitdem gibt es eine Hängepartie, aber es schält sich heraus, dass das kommende Gremium anders sein wird: Mit nochmals halbierter Sitzungfrequenz, geringerer Beteiligung, der Verdrängung aktiver Bewohner:innen und der Reduzierung auf einen Antrag pro Veranstaltung.
Insofern stelle ich die Frage nach einer autonomen, selbstbewussten Interessenvertretung auf Stadtteilebene im Rahmen eines städtisch-parlamentarisch geprägten und von konservativen Kräften dominierten „Modell“ Stadtteilbeiräte neu. Zumindest für St. Georg. Und das nach Jahrzehnten erfolgreichen Wirkens wenigstens in der Hinsicht, ausdiskutierte und beschlossene „Stadtteilmeinung“ in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Regelmäßig.
Autor
Michael Joho ist Vorsitzender des alternativen »Einwohnervereins St. Georg von 1987 e.V.« und für diesen seit den 1990er Jahren im Stadtteilbeirat St. Georg.
Weiterlesen
▷ M. Joho: Metropolendemokratie von unten erfordert starke Stadtteilbeiräte. In: Mehr als schöne Worte? BürgerInnenbeteiligung in Hamburg. Hrsg. von der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft. Hamburg 2014. S. 32–42
▷ Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte (Hrsg.): Nur mit uns! Stadtteilbeiräte: Mitgestalter vor Ort brauchen Absicherung! Hamburg 2016
▷ M. Joho: Macht die Stadtteilbeiräte zu Säulen der Stadtteildemokratie in Hamburg! In: Lebenswertes Hamburg. Eine attraktive und soziale Stadt für alle? Hrsg. von Gerd Pohl und Klaus Wicher. Hamburg 2019. S. 145–164
▷ Jürgen Fiedler: Bürgerbeteiligung – zwischen Legitimationsdruck und Praktikabilitätshürde. In: Jahrbuch 2019/2020 der Patriotischen Gesellschaft von 1765. Hamburg 2020
▷ Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte
▷ Zur Arbeit des Stadtteilbeirats St. Georg siehe die Stadtteilzeitung des Einwohnervereins St. Georg von 1987 e.V. „Der lachende Drache“ und die aktuellen Meldungen: ▷ Einwohnerverein St. Georg
Titelillustration
© Rainer Midlaszewski
Zur Entwicklung und Bedeutung des Gewerkschaftshauses vor 1933
Vortrag von Michael Joho anlässlich der DGB-Gedenkveranstaltung zum 90. Jahrestag der Besetzung des Gewerkschaftshauses am 2. Mai 2023 im Musiksaal
Die Besetzung der gewerkschaftlichen Einrichtungen durch die Nationalsozialisten am 2. Mai 1933 war nicht nur eine politische Zäsur mit einschneidenden Folgen für die Verbände und viele ihrer Mitglieder. Der 2. Mai steht auch für das dramatische Ende einer Ära, in der das von quirlendem Leben erfüllte Gewerkschaftshaus im Fokus der arbeitenden Menschen stand.
Mein kurzer, auch ein wenig nostalgischer Rückblick soll veranschaulichen, welche Rolle das Gewerkschaftshaus für die hamburgische Arbeiter:innenbewegung bis zu ihrer gewaltsamen Unterdrückung spielte. Dafür mag exemplarisch ein Zitat von Hans Saalfeld (1928-2019) stehen, des langjährigen DGB-Vorsitzende in Hamburg von 1969 bis 1988: „Schon auf Kindesbeinen, in der Endzeit der Weimarer Republik, kam ich mit meinen Eltern und meiner vier Jahre älteren Schwester zum Besenbinderhof“, erinnerte er sich anlässlich des Jubiläums zum 100jährigen Bestehen des Hauses 2006. „Vor der Gewerkschaftshausgaststätte standen oft Lieferfahrzeuge der Konsumgenossenschaft ‚Produktion‘ und der ‚GEG‘. (…) Häufig fand an Sonntagvormittagen im großen Festsaal des Gewerkschaftshauses eine Matinee statt. Die habe ich oft mit der Familie besucht. (…) Man konnte nach der Matinee in der Gaststätte des Gewerkschaftshauses auch gut und günstig essen. Ein Eisbein mit Sauerkraut und Erbsenpüree kostete 0,95 Reichsmark. Später 1,10. Hierfür war das Gewerkschaftshaus berühmt. Bis Ende April 1933 blieb der Kontakt zum Gewerkschaftshaus erhalten.“[1]
Was war das für ein Gebäude, für ein Zentrum, in das – zumindest an Sonntagvormittagen – sogar Kinder mitgenommen wurden? Wo tausende Menschen zu Versammlungen im Haus zusammenströmten? Und wo es in Hochzeiten hunderte Portionen Eisbein gab, übrigens bis in die 1970er Jahre? Blicken wir dafür zunächst auf die Vorgeschichte des Gewerkschaftshauses zurück.
Steht das zweite Drittel des 19. Jahrhunderts für die Industrialisierung und die Herauskristallisierung eines schnell wachsenden Proletariats, erfolgte der Durchbruch der Arbeiter:innenbewegung im letzten Drittel des Jahrhunderts, sprunghaft vor allem nach Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890. Schon 1877, also unmittelbar vor Verhängung des Bismarckschen „Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“, hatten 9 von 30 reichsweit organisierten Gewerkschaften in Hamburg oder im damals noch preußischen Altona ihren Hauptsitz. 1890 war Hamburg die Zentrale bereits für 25 von 57 sich zur Sozialdemokratie bekennenden Gewerkschaften. Also nicht zufällig wurde hier auch die 1890 gebildete „Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands“ unter Leitung von Carl Legien (1861-1920) ansässig.[2] Allerdings nicht ganz ohne Widerspruch, wie das Protokoll des ersten Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands im März 1892 in Halberstadt zeigt: Zwei Delegierte beantragten, den Hauptsitz der Generalkommission nach Stuttgart zu verlegen, um „die unberechtigten Vorwürfe (zu beseitigen), dass die Hamburger Gewerkschaften die in anderen Städten terrorisiren wollen“.[3]
Das erste Gewerkschaftshaus von 1906 (Ansichtskarte)
Und alle diese Verbände benötigten natürlich Büroräume für Verwaltung und Beratung, die bis dato über die ganze Stadt verteilt waren. Aber sie brauchten natürlich viel mehr. Denn wir haben es vor gut 100 Jahren mit einer außerordentlich versammlungsfreudigen Arbeiterklasse zu tun. Und deren Organisationsgrad schwoll an. Waren es 1890 noch 30.500 Gewerkschaftsmitglieder, lag die Zahl Anfang 1914 schon bei 133.000. Doch wo sich treffen, wo konnten überhaupt Versammlungen stattfinden? Nicht einmal den Vereinen des Arbeitersports traute der Senat, die Nutzung von Schulturnhallen wurde ihnen verwehrt, bis die Partei der „Vaterlandsverräter“ 1914 zu „Vaterlandsverteidigern“ wurde. Für die Zusammenkünfte der Arbeiter mussten meist Gaststätten und deren große Gesellschaftsräume herhalten. Für die so genannten „Arbeiterwirte“ war das wegen ihrer sozialdemokratischen Gesinnung kein Problem. Sehr wohl aber war es eines für diejenigen Kneipenbesitzer, die abwägten zwischen der Trinkfreudigkeit der Partei- und Gewerkschaftsmitglieder einerseits und der großen Zahl der Soldaten andererseits. Letzteren untersagten die Militärbehörden nämlich oftmals den Besuch von Lokalen mit arbeiterbewegtem Publikum.
Neben dem wachsenden Mangel an Büro- und Versammlungsräumen gab es noch eine dritte Herausforderung: die auf der Suche nach Anstellung reisenden Arbeiter und Gesellen, die sich in guter Tradition bei ihrer Gewerkschaft meldeten und um Unterstützung bei der Vermittlung von Unterkunft und Arbeit baten. Alleine 1893 zahlten Hamburgs 26 Gewerkschaften Reiseunterstützung an 10.000 Kollegen aus. Die Schaffung einer günstigen und sauberen Zentralherberge stand daher mit am Anfang der Überlegungen, eigene Räumlichkeiten zu schaffen.
Die Geschichte dieser Planungen ist schnell erzählt. 1894 gab es im Hamburger Gewerkschaftskartell erstmals eine Diskussion über ein eigenes Gewerkschaftshaus. Auch in anderen Städten wurde diese Debatte geführt, wenn auch anfangs oft noch kontrovers. Als Gegenargumente wurden die leichte Zugriffsmöglichkeit des kaiserlichen Staates auf das in einem großen Gebäude geronnene Geld und die fragwürdige, dauerhaft ökonomische Leistbarkeit ins Feld geführt. Doch das allenthalben ausbrechende „Gründungsfieber“ sorgte im ganzen Deutschen Reich bis zum I. Weltkrieg für die Schaffung von rund 80 Gewerkschafts- und Volkshäusern, die vor einigen Jahren erstmals in einem Buch von Anke Hoffsten zusammengefasst wurden.[4] In Hamburg verdichteten sich die Pläne ab 1900, so dass ein finanzieller Grundstock angelegt wurde. 1904 schließlich sorgte das Angebot eines größeren Areals am Besenbinderhof für einen Quantensprung bei den Aktivitäten. Es wurde eine „Gewerkschaftshaus Hamburg GmbH“ gegründet, das Grundstück für 275.000 Mark erworben und der 1,5 Millionen Mark teure Bau unter Leitung des Architekten Heinrich Krug (1877-1923) ab August 1905 innerhalb von 15 Monaten verwirklicht. Dieser finanzielle Riesenaufwand konnte nur bewältigt werden, weil neben den Gewerkschaften auch die SPD und die „Konsum-, Bau- und Sparvereinigung Produktion“ mit großen Summen und Darlehen aushalfen. Doch letztlich kam alles durch die sprichwörtlichen „Arbeitergroschen“ zusammen, staatliche Hilfe gab es nicht.
Vielleicht noch ein Wort zur Lage, denn heute wirkt das Gewerkschaftshaus ja ein bisschen verloren, eingeklemmt zwischen der Kurt-Schumacher-Allee und dem ZOB nach vorne und dem Bahnkörper nach hinten. Schauen wir aber ein gutes Jahrhundert zurück, stellt sich die Lage ganz anders dar: Nach vorne lag St. Georg-Nord mit seinen fast 44.000 BewohnerInnen 1900, ein überwiegend kleinbürgerliches Quartier mit nur wenigen Arbeiterwohnstraßen. Aber nach hinten lag mit St. Georg-Süd – wie der heutige Stadtteil Hammerbrook bis zum Groß-Hamburg-Gesetz 1937 noch hieß – das größte, nahezu homogene Proletarier:innenquartier Hamburgs. 1900 lebten hier 53.000 Menschen, weit überwiegend aus einfachen Arbeiter- und Handwerkerhaushalten. Genau hier holte August Bebel (1840-1913) seine Stimmen bei den Reichstagswahlen. Zwischen 1883 und 1893 und von 1898 bis zu seinem Tod 1913 wurde er als Hamburger Abgeordneter aus dem Wahlkreis I – bestehend aus der Altstadt und ganz St. Georg – entsandt. Im Wahlbezirk 41 (Hammerbrook- und Süderstraße) bekam er 1890 nahezu unglaubliche 94 % der Stimmen. Die Süderstraße hatte im Volksmund bereits seit 1883 den Namen als Bebels Allee weg.
Auch insofern lag es auf der Hand, dass Bebel die Festrede bei der Einweihung des Gewerkschaftshauses am 29. Dezember 1906 hielt. Ein Redner, dessen Ankündigung alleine „eine wahre Völkerwanderung nach dem Besenbinderhof und den anliegenden Straßen verursacht“,[5] wie es mit Blick auf eine Wahlrede 1907 hieß. Ähnlich muss es auch am 29. Dezember 1906 gewesen sein. 5.000 Menschen drängten sich im Gewerkschaftshaus, lauschten den Ansprachen, aber auch den Gesangsdarbietungen und zum Abschluss der „Marseillaise“.
Bebel prägte an diesem Tag das Wort vom Gewerkschaftshaus als „geistiger Waffenschmiede“. Aber er hat viel ausführlicher skizziert, worum es der Gründergeneration ging – und wie stolz die Arbeiterschaft auf diesen Bau war: „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, daß neben dem Rathause und dem Zentralbahnhof als dritte bauliche Sehenswürdigkeit unser Gewerkschaftshaus zu nennen sei. Man wird jetzt Respekt haben vor dem Können der so viel verachteten Arbeiterklasse. Dieses Haus soll den verschiedensten Zwecken dienen, es soll sein in erster Linie ein Haus der Arbeit, worauf die zahlreichen Bureauräume und Beratungszimmer hindeuten. Es soll weiter sein ein Haus der Belehrung und Aufklärung, wo durch Benutzung der Bibliothek usw., die durch die mangelhafte Volksschule nicht beseitigten Lücken ausgefüllt werden sollen. Es birgt das Arbeiter- und Gewerkschaftssekretariat in seinen Räumen, wo Auskünfte aller Art und Belehrung auf sozialpolitischem Gebiete erteilt werden. Es soll aber auch ein Haus der Ruhe und Erholung für die wandernden Genossen sein, die, den ‚Berliner‘ auf dem Rücken, von der Wanderlust getrieben oder auch auf das Straßenpflaster geworfen, nach Hamburg kommen, um hier Arbeit zu suchen. (…) Dies Haus soll aber auch unsere geistige Waffenschmiede sein, wo nicht nur die Kämpfe zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter beschlossen, sondern auch die Kriegspläne beraten werden, wie dem Proletariat dauernd geholfen werden könne.“[6]
Der Stolz der hamburgischen Arbeiter:innenbewegung auf dieses Gebäude war überwältigend. Alleine der Umstand, dass es „keinerlei Arbeitsunfälle“ gegeben habe, unterstrich nach eigenem Verständnis die Überlegenheit der organisierten Arbeiterklasse, die im neuen Jahrhundert endlich die Früchte des jahrzehntelangen Ringens einfahren würde. „Ein Hauch der Zukunft“ durchwehe dieses und überhaupt alle Gewerkschaftshäuser, hieß es im „Hamburger Echo“.[7]
Alle von Bebel erwähnten Zielvorgaben stellten sich binnen kurzem ein. Das Gewerkschaftshaus entwickelte sich zu einem eigenen Kosmos. Genutzt wurden nun die verbindbaren Veranstaltungsräume für bis zu 5.000 Personen, Dutzende Büros und Zahlstellen waren besetzt, Informationen und Rechtsberatung holten sich die Kolleg:innen im Arbeitersekretariat, Zeitungen konnten im Lesesaal studiert und Bücher ausgeliehen werden, gegessen wurde im Gewerkschaftsrestaurant, und die Herberge bot Schlafräume für 156 Gäste, dazu acht Einzelschlafzimmer „für durchreisende Delegierte, Referenten etc.“.[8]
Die Nutzung des Gebäudes war so intensiv, dass binnen weniger Jahre die Kapazitäten nicht mehr ausreichten, zumal auch das Wachstum der Mitgliederzahlen weiter anhielt. Hinter dem Gewerkschaftshaus entstand 1908 ein weiterer Bau im Stile eines Kontorhauses, in das insbesondere die „Zentralkommission für das Arbeiterbildungswesen“ samt Hörsaal einzog. Hier soll u.a. Max Brauer (1997-1973) seine politische Grundausbildung erfahren haben. Zur Repsoldstraße hin wurde 1910 ein Grundstück erworben, um in dem darauf befindlichen Wohngebäude ein „Hotel Gewerkschaftshaus“ einzurichten, das 1911 aber dann ebenfalls in Büroraum umgewandelt wurde. Vor allem aber entstand am linken Rand – zum Gebäude der „Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine“/GEG hin – ab Oktober 1912 innerhalb eines Jahres ein großer Neubau für 1,3 Millionen Mark. Architekt war Wilhelm Schröder, der Teile des Ursprungsbaus abreißen ließ, um eine Verbindung zum Neubau herzustellen. Die Übergänge sind auch heute noch auf der Höhe des Treppenhauses zu spüren, wenn man vom einen in den anderen Teil wechselt.
Das Hamburger Gewerkschaftshaus nach seiner Erweiterung 1913 (Ansichtskarte)
Jedenfalls erweiterte sich die Grundfläche des Gewerkschaftshauses mit dem Anbau von 2.300 auf 4.390 Quadratmeter. Am 3. Oktober 1913 wurde das doppelt so groß gewordene Gewerkschaftshaus dann sozusagen ein zweites Mal eingeweiht. Festredner war Otto Stolten (1853-1928), ab 1901 Hamburgs erster Sozialdemokrat in der Hamburgischen Bürgerschaft, der 1913 als Nachfolger des verstorbenen August Bebel auch in den Reichstag einzog. Nunmehr war der Komplex am Besenbinderhof das größte Haus der deutschen Gewerkschaftsbewegung überhaupt und – laut Hamburger „Bau-Rundschau“ (von 1921) – auch das schönste: mit wunderbaren Holzfriesen und -plastiken sowie mit den von den einzelnen Gewerken finanzierten Mosaikfenstern im Restaurant – Überreste sind noch im 10. Stock zu bewundern. Bis 1977 sollten damit auch bauliche Erweiterungen zum Abschluss gekommen sein, von der Beseitigung der im II. Weltkrieg angefallenen Schäden einmal abgesehen.
Um zusammenfassend die Vielfalt der Räumlichkeiten und der Nutzungen zu veranschaulichen, will ich aufzählen, was dieser Komplex kurz vor dem Ersten Weltkrieg beherbergte: Versammlungsräume für mittlerweile 8.000 Personen, darunter der erst 2016 wieder eröffnete Musiksaal für ursprünglich 600 Besucher:innen, mehrere Gaststätten mit ca. 2.000 Plätzen. Mittlerweile 187 Angestellte des Gewerkschaftskartells verteilten sich auf 83 Büros, 23 örtliche Zahlstellen von Einzelverbänden, sechs Gauverwaltungen, drei Vorstände von Zentralverbänden, das Arbeitersekretariat, das Gewerkschaftskartell, die Rechnungsstelle der Volksfürsorge, die Bauarbeiterschutzkommission, die Verwaltung des Hauses, die Wohnung des Ökonomen, ein Krankenkassenbüro, einige Arbeitsnachweise, Anlaufstellen für Arbeitssuchende, die Bibliothek samt Lesezimmer der Zentralkommission für das Arbeiterbildungswesen. Ein Blick in die, von der „Gesellschaft Gewerkschaftshaus mbH“ Anfang 1914 herausgegebene, wunderbar bebilderte Festschrift sei in diesem Zusammenhang nur allen empfohlen.[9]
Mit diesem vielschichtigen Raumangebot wurde das Gewerkschaftshaus alleine schon von den Ausmaßen her zu dem herausragenden Zentrum der hamburgischen Arbeiter:innenbewegung und – in bestimmten Situationen – auch zum Brennpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Nehmen wir beispielhaft nur einige bedeutende Anlässe, zu denen sich die Räume im Haus oder die unmittelbare Umgebung zunutze gemacht wurden.
Im Juni 1908 wurde hier der 6. und 1928 der 13. Kongress der Gewerkschaften Deutschlands abgehalten, 1919 die 21. Generalversammlung des Zentralverbandes der Zimmerer. 1921 sah das Haus die erste öffentliche Kundgebung der Arbeiterjugendinternationale nach dem Krieg, zwei Jahre später wurde hier die Sozialistische Arbeiter-Internationale (SAI) und gleich danach die Sozialistische Jugendinternationale ins Leben gerufen. 1924 tagte hier der erste Bundestag des deutschen Baugewerksbundes, es folgte 1926 der 15. Bundestag des Arbeiter- Turn- und Sportbundes (ATSB) usw.
1907 war das Haus der Ort, an dem der Arbeiter Samariter-Bund (ASB) gegründet wurde, 1919 die Volksbühne Hamburg, 1920 der Gemeinnützige Bestattungsverein (heute: Ge-Be-In), 1922 die Gemeinnützige Baugenossenschaft freier Gewerkschafter, 1925 die Gemeinnützige Kleinwohnungsbau-Gesellschaft Groß-Hamburg (aus der später die Neue Heimat hervorging), 1926 die Internationale der Arbeitersänger usw.
Vis-à-vis zum Haus fand am 18. August 1916 die erste Anti-Kriegskundgebung im I. Weltkrieg statt; am 5. November 1918 nahmen hier 10.000 Menschen an einer USPD-Kundgebung teil, auf der der umfassende Streik zur Unterstützung der revolutionären Matrosen in Kiel ausgerufen wurde; ab dem 6. November 1918 ging die politische Macht in der Stadt für kurze Zeit direkt vom Gewerkschaftshaus aus, als sich hier der Arbeiter- und Soldatenrat einrichtete.
„Ununterbrochen, von morgens bis in die Nacht, herrscht hier Großbetrieb“, war in einer Broschüre der Arbeiterjugend 1925 zu lesen.[10] „Man muß gesehen haben, wie das Leben im Haus vibriert“, schrieb Karl Odenthal, Geschäftsführer des Gewerkschaftshauses, in einer Art Hohelied. „Ständiges Kommen und Gehen. Hunderte, Tausende besuchen am Tage ihre Organisationen. Das Treppenhaus ist an manchen Stunden des Tages für die Menschen zu eng. Viel Elend wird durch die Enge hinaufgeschleppt, aber auch viel Zufriedenheit herunter. (…) Oft Versammlungen in allen Sälen, Tausende faßt das Haus. In nimmermüdem Arbeiten durch all die Kleinarbeit dem Ziele entgegen. Mancher besucht sein Haus Tag für Tag!“[11]
Einen Tropfen Essig will ich trotz dieser optimistischen, ja, fast fröhlichen Einschätzung hinzufügen. Es geht um die Konflikte innerhalb der Arbeiter:innenbewegung, die sich ab Mitte der 1920er Jahre immer deutlicher herausschälten. Zwar gab es nach der Bürgerschaftswahl im Oktober 1927 noch den Versuch von SPD und KPD unter Vermittlung des ADGB, eine „Arbeiterregierung“ zu bilden, doch diese endete in gegenseitigen Vorwürfen und scheiterte damit binnen weniger Tage. In den darauffolgenden Jahren vertiefte sich der Graben auch in der Gewerkschaftsbewegung, neben dem sozialdemokratischen ausgerichteten ADGB entstand 1928/29 die „Revolutionäre Gewerkschaftsopposition“ (RGO), die sich nun auch auf betrieblicher Ebene bekämpften. Bisweilen schwappte diese Auseinandersetzung auch direkt ins Gewerkschaftshaus hinein, beispielsweise am 4. Dezember 1930, als Fritz Wildung (1872-1954), der Geschäftsführer der „Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege“ im Großen Saal auftrat. Müßig, über den Anlass zu berichten, es kam jedenfalls zu einer Saalschlacht zwischen dem Reichsbanner-Saalschutz und oppositionellen Arbeitersportlern, in dessen Verlauf Dutzende Verletzte und ein Toter zu beklagen waren.[12]
In die Schlussphase der Weimarer Republik und damit mitten in der Weltwirtschaftskrise wurde das 25jährige Jubiläum des Gewerkschaftshauses begangen. Die Feier am 29. Dezember 1931 fiel angesichts der verbreiteten Not schlicht aus, alleine von den 186.000 Gewerkschaftsmitgliedern waren zu diesem Zeitpunkt fast 81.000 von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Festansprache hielt der stellvertretende ADGB-Bundesvorsitzende Peter Graßmann (1873-1939). Er geißelte in vergleichsweise scharfem Ton das Versagen des kapitalistischen Systems, appellierte aber auch an „die Führer des heutigen Staates endlich Ernst (zu) machen mit der Verteidigung der Republik gegen ihre Feinde“. Es habe sich „die Richtigkeit der marxistischen Grundauffassung (bestätigt), zu der sich die organisierte Arbeiterschaft mit besonderem Stolz bekennt, obgleich die sogenannte ‚Arbeiterpartei‘ der Nazis ihr deswegen einen Makel anhängen will.“[13]
Ganz in diesem Sinne organisierte die „Eiserne Front“ – der Zusammenschluss von SPD, Gewerkschaften, Arbeitersportverbänden und Reichsbanner zum Schutz der Republik – vom 14. bis 21. Februar 1932 eine so genannte „Rüstwoche“, eine politische Aktion als Bekenntnis gegen den immer stärker werdenden Faschismus. Beginnend mit einer Auftaktveranstaltung natürlich im Gewerkschaftshaus wurde die hamburgische Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in einem der zahlreich ausgelegten „Eisernen Bücher“ einzutragen, um zu bekennen: „Rüstwoche ist Großkampfwoche. Rüstwoche ist Volksentscheid gegen Faschismus und Kapitaldiktatur. Jeder Mann, jede Frau, jeder Jugendliche zeichnet sich ein in das Eiserne Buch!“[14] Bis Ende März 1932 kamen so 132.610 Unterschriften zustande. Eigentlich eine gute Voraussetzung für die Verteidigung der Republik und konkret auch des Gewerkschaftshauses.
Zu dessen Schutz wollte übrigens auch eine Anzahl jüngerer Kollegen beitragen, wie sich Adolph Kummernuss (1895-1979) – damals in der Ortsverwaltung des Gesamtverbandes der Arbeitnehmer der öffentlichen Betriebe, des Personen- und Warenverkehrs, später ÖTV-Vorsitzender – erinnerte. „Wir lagen wochenlang im Hamburger Gewerkschaftshaus, besonders nachts, in Alarmbereitschaft. Wir hatten auch Waffen. Der Leiter unserer Gruppe im Gewerkschaftshaus war Heinrich Steinfeldt. Bis Ende April 1933 haben wir dort fast jede Nacht, hauptsächlich auf der Kegelbahn zugebracht, mit stündlicher Ablösung. Dann kam Jonny Ehrenteit von einer Sitzung aus Berlin zurück. Der Vorstand des ADGB und befreundete Organisationen haben getagt und empfahlen: ‚Keinen Widerstand – alles zwecklos!‘ In der Stunde begann für mich die illegale Arbeit.“[15]
Doch vom Untergang des alten Hamburger Gewerkschaftshauses – der „Stätte sozialistischer Kultur“, wie das Karl Odenthal noch 1929 formuliert hatte,[16] und den Folgen nach dem 2. Mai 1933, darüber an anderer Stelle mehr.
[1] Hans Saalfeld: Das Gewerkschaftshaus – ein Stück meines Lebens! In: „Dies Haus soll unsere geistige Waffenschmiede sein“ (August Bebel). 100 Jahre Hamburger Gewerkschaftshaus (1906 – 2006). Von Michael Joho. Hrsg. vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hamburg. Hamburg 2006. S. 11.
[2] Joho 2006, S. 16 f.
[3] Protokoll der Verhandlungen des ersten Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands, Abgehalten zu Halberstadt vom 14. Bis 18. März 1892. Hamburg 1892 (Reprint Köln 1991). S. 71.
[4] Anke Hoffsten: Das Volkshaus der Arbeiterbewegung in Deutschland, Gemeinschaftsbauten zwischen Alltag und Utopie. Wien/Köln/Weimar 2017. S. 43 f.
[5] Hamburgischer Correspondent, vom 24.1.1907.
[6] Hamburger Echo, vom 1.1.1907.
[7] Hamburger Echo, vom 6.1.1907.
[8] Hamburger Echo, vom 25.12.1906.
[9] Verlag Gesellschaft Gewerkschaftshaus m.b.H. (Karl Hense) (Hrsg.): Ein Führer durch das Hamburger Gewerkschaftshaus. Hamburg 1914.
[10] Volk von morgen. Der Hamburger Reichsjugendtag der deutschen Arbeiterjugend, von ihr selbst geschildert. Berlin 1925. S. 28.
[11] Ortsausschuß Groß-Hamburg des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes/Ortskartell des Allgemeinen freien Angestelltenbundes/Landesausschuß Groß-Hamburg des Allgemeinen Deutschen Beamtenbundes/Kartell für Arbeiterbildung, Sport und Körperpflege Groß-Hamburg (Hrsg.): Fest der Arbeit. Sonntag, 24. August 1924, im Hamburger Stadtpark. Hamburg, August 1924. S. 18 f.
[12] Joho 2006, S. 80 f.
[13] Hamburger Echo, vom 30.12.1931.
[14] Hamburger Echo, vom 12.2.1932.
[15] Interview, vollständig abgedruckt in: Ursel Hochmuth/Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933 – 1945. Frankfurt a.M. 1980. S. 98-100.
[16] Karl Odenthal: Gewerkschaftshäuser. In: 25 Jahre Gewerkschaftshaus Hamburg G.m.b.H. Herausgegeben anläßlich der Jubiläumsfeier am 12. Juni 1929. Hamburg 1929. S. 7.
Der nachfolgende Beitrag findet sich in dieser Broschüre:
Mehr als schöne Worte? BürgerInnenbeteiligung in Hamburg
Hrsg. von der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft. Hamburg, im Mai 2014. S. 32 – 36. Im Netz unter https://www.linksfraktion-hamburg.de/wp-content/uploads/2015/10/DIE_LINKE_HH_Fraktion_Broschuere_Beteiligung_Mai_2014_Web.pdf.
Metropolendemokratie von unten erfordert starke Stadtteilbeiräte
von Michael Joho
Es ist Bewegung in eine Angelegenheit gekommen, die bis vor gut anderthalb Jahren lange Zeit einfach so »durchgelaufen« war: die regelmäßige, mehr oder weniger stille Auflösung von Sanierungs-, Quartiers- und Stadtteilbeiräten nach Beendigung ihrer von Politik und Behörden zugestandenen Laufzeit.
Rund 50 existierende Gremien dieser Art wurden Anfang September 2012 in der Senatsantwort auf eine Große Anfrage der Linksfraktion zum Thema »Bürgerbeteiligung« aufgelistet, ein gutes Drittel davon sollte plangemäß bis Ende 2013 auslaufen. Finanziert werden diese Beteiligungsgremien seit 2009 grundsätzlich aus dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE), aber nur für den Zeitraum, in dem aus städtischen Mitteln auch Maßnahmen im jeweiligen Gebiet unterstützt werden. Die dahinter stehende Philosophie liest sich in der Senatsantwort auf die Anfrage der LINKEN so: »Die Laufzeit dieser Gremien ist in der Regel an die Realisierung eines bestimmten Projekts, die Lösung bestimmter Probleme oder die Durchführung eines bestimmten Verfahrens gekoppelt. Die Förderung von Beteiligungsstrukturen ist deshalb auch in der Integrierten Stadtteilentwicklung grundsätzlich nur für festgelegte Gebiete und für eine befristete Laufzeit möglich. Eine pauschale flächendeckende Einrichtung von über die gewählten bezirklichen Gremien hinausgehenden zusätzlichen Beteiligungsgremien wäre weder sachlich angemessen noch stehen hierfür die finanziellen Ressourcen zur Verfügung.«[1] Dauerhafte Beteiligungsstrukturen seien »weder sachlich angemessen«, und für sie ständen auch keine »finanziellen Ressourcen zur Verfügung« – haben wir richtig gelesen?
Der Senat vertritt damit eine Argumentation, die vielleicht noch in der jüngeren Vergangenheit verfangen hat, aber im 21. Jahrhundert endgültig obsolet geworden ist. Denn BürgerInnenbeteiligung ist keine Sache, die einen Anfang und ein Ende hat, je nachdem, wann irgendwelche Fördermaßnahmen auslaufen. BürgerInnenbeteiligung ist vielmehr eine dauerhafte Anforderung an Politik und Verwaltung, eine demokratische Herausforderung, ohne deren ernsthafte Berücksichtigung Metropolen nicht mehr funktionsfähig sind. Und was heißt, es stehe kein Geld für die langfristige Absicherung der Beiratsarbeit zur Verfügung? Alleine der umstrittene Neubau der Mahatma-Gandhi-Brücke in der HafenCity kostet wenigstens 12,5 Mio. Euro – davon könnten in sämtlichen Stadtteilen Beteiligungsgremien für die nächsten Jahre finanziert werden, für Gremien, die wiederum dafür Sorge tragen oder zumindest lautstark Kritik üben könnten, dass Geld nicht fehlinvestiert wird. Wie auch im Falle eines geplanten Kreisels im Rahmen des Busbeschleunigungsprogramms für die Lange Reihe: Hier soll eine gute halbe Million Euro versenkt werden, ohne dass im Stadtteil(beirat) St. Georg irgendjemand die Notwendigkeit dieser baulichen Veränderung nachvollziehen könnte, die den Bussen die sagenhafte Zeitersparnis von drei Sekunden einbringen soll.
Institutionalisierte BürgerInnenbeteiligung, wie sie sich in den Stadtteilbeiräten darstellt, ist ein gewichtiges Element unserer Metropolendemokratie. Wenn zu jeder Sitzung der rund 50 Beiräte auch nur 20 Personen kämen – in St. Georg beispielsweise waren es bis Ende 2013 im Durchschnitt allmonatlich 70 bis 80 Personen –, dann hätten wir es heute schon mit mindestens 1.000 BürgerInnen zu tun, die sich regelmäßig und verantwortlich um ihr Quartier kümmern. Das sind die ExpertInnen vor Ort, das ist stadtteilbezogenes Wissen und Engagement par excellence, das es zu pflegen und nicht abzuwickeln gilt! Einige dieser ehrenamtlich engagierten Gremien – moderiert und betreut oftmals von professionellen Planungsbüros etc. – sind bereits seit langem aktiv, seit 1979 und damit am längsten in Hamburg der Stadtteilbeirat St. Georg, der mit wechselnden Namen immer wieder neue Fördertöpfe anzapfen und dadurch weiterbestehen konnte. Doch im Jahr 2014 ist dessen jährliche Sitzungszahl von zehn auf fünf reduziert worden, und 2015 soll die Förderung endgültig auslaufen (entsprechend dem Ende des RISE-Fördergebiets). Die SPD Hamburg-Mitte spricht in diesem Zusammenhang gerne davon, dass der Stadtteilbeirat St. Georg mit seinen jahrzehntelangen Erfahrungen doch mit »selbsttragenden Strukturen« weitermachen könne – aber eben ohne finanzielle Förderung seitens der Stadt. Wertschätzende Stadtteildemokratie sieht wahrlich anders aus.
Überhaupt scheinen die BeiRÄTE dem Senat eher unangenehm, jedenfalls kein besonderes Anliegen zu sein, in dem einen oder anderen Fall gelten sie wohl auch eher als Störfaktor in der repräsentativen Demokratie. In einer im Oktober 2013 von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) herausgegebenen Broschüre zur BürgerInnenbeteiligung in Hamburg wird auf 42 Seiten allerlei Interessantes zur Partizipation ausgeführt, das halbe Hundert Beiratsgremien findet jedoch nur ein einziges Mal Erwähnung, auf Seite 11 – in einer Klammer: »In Gebieten der Integrierten Stadtteilentwicklung (...) ist die kontinuierliche Mitarbeit der Bewohnerinnen und Bewohner ein Grundprinzip (z.B. über Beiräte).«[2] Von wegen Grundprinzip, denn die Anerkennung und Förderung des langfristigen Engagements von Beiräten vor Ort wird per RISE-Definition bisher ausgeschlossen.
Es ist zu einem Gutteil dem Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte zu verdanken, seit Sommer 2012 verstärkt durch einzelne AkteurInnen aus dem Netzwerk »Recht auf Stadt«,[3] die dauerhafte Absicherung der Stadtteilbeiräte zu einem Thema der öffentlichen Auseinandersetzung gemacht zu haben, und zwar durchaus mit Erfolg. Eine am 4. Oktober 2012 vorgelegte »Erste Resolution zur Verstetigung und Ausweitung der Stadtteilbeiräte« wurde von über 20 Beiratsgremien und mehr als 50 Einzelpersonen unterzeichnet. Der Tenor: Für eine lebendige Stadtteil- und Quartiersdemokratie sind Beiratsstrukturen, so unterschiedlich sie auch ausfallen, unerlässlich. Eine solche Beteiligung könne von den Behörden nicht einfach für beendet erklärt und der Geldhahn abgedreht werden, nur weil ein bestimmtes Förderprogramm ausläuft. Beiräte dürfen nicht eingedampft oder abgewickelt werden, sie müssen vielmehr erhalten und da, wo gewünscht, neu geschaffen werden.
In einer »Zweiten Resolution« vom 16. Juli 2013 haben die o.a. InitiatorInnen nachgelegt. Mit gewachsenem Selbstbewusstsein wird nun ein eigener »Etatposten Beiräte« im städtischen Haushalt eingefordert, quasi als institutionalisierte unterste Ebene der Beteiligung von BürgerInnen, die ihr Quartier aktiv mitgestalten wollen. Gedacht wird z.B. an ein Initiativrecht und die Beteiligung an Planungsverfahren. Gewünscht wird auch eine gesetzliche Absicherung von Mitwirkungsstrukturen auf Stadtteil- und Quartiersebene. Auch diese Resolution ist mittlerweile von etwa der Hälfte der Gremien angenommen worden.[4]
Es war in der Hamburgischen Bürgerschaft zuerst die Linksfraktion, die auf diese Entwicklungen nicht nur mit der Großen Anfrage, sondern auch mit einem Antrag reagierte. Im Rahmen der Debatte des Doppel-Haushalts 2013/2014 forderte sie am 29. November 2012 eine »Aufstockung des Haushaltstitels ›Stadtwerkstatt‹ für die Verstetigung und Ausweitung von Quartiers- und Stadtteilbeiräten« auf eine Mio. Euro (2013) bzw. drei Mio. Euro (2014), vorrangig für die institutionelle Sicherung auslaufender und ab 2014 gezielt für die Schaffung neuer Beiratsgremien.[5] Der Antrag wurde mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP bei Enthaltung der GRÜNEN jedoch abgelehnt. Wenig später legten auch die Fraktionen der CDU und der GRÜNEN mit vergleichbaren Haushaltsanträgen nach, doch diese wurden ebenfalls nicht angenommen.[6] Der Antrag der Mehrheitspartei, mit dem ein projektbezogener »Quartiersfonds bezirkliche Stadtteilarbeit« – 2013 und 2014 jeweils mit 1,5 Mio. Euro ausgestattet – geschaffen werden sollte, fand die Unterstützung von SPD, FDP und der LINKEN bei Ablehnung durch die CDU und Enthaltung der GRÜNEN.[7] 46 Eine institutionelle Anerkennung und Förderung der Beiräte war kein Thema dieses Antrages.
Doch das Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte hat seitdem keineswegs aufgegeben, die Verankerung der Beiräte weiter voranzubringen. Auf einem Kongress mit über 100 StadtteilvertreterInnen am 27. April 2013 in Steilshoop – unter dem Motto: »Demokratie im Stadtteil – Nur mit uns!« – wurden die dann in der Zweiten Resolution vom 16. Juli 2013 berücksichtigten Forderungen diskutiert und konkretisiert. Damit war die Latte für die Politik noch höher gelegt, die Beiräte-Frage inzwischen auf verschiedenen Ebenen und in den Medien zunehmend aufgegriffen worden. Zum Jahreswechsel 2013/2014 kulminierte diese Entwicklung schließlich in der erneuten Vorlage von Anträgen der Bürgerschaftsfraktionen. Den Anfang machte am 5. Dezember 2013 erneut DIE LINKE, die sich uneingeschränkt für den Erhalt und die Verstetigung der Stadtteilbeiräte sowie einen eigenen Etatposten »Beirätearbeit im Stadtteil« einsetzte. Erneut wurde dieser Antrag von den Fraktionen der SPD, CDU und FDP bei Enthaltung der GRÜNEN niedergestimmt.[8] Es folgte der Antrag der GRÜNEN, der die Prüfung von europäischen Fördermitteln vorsieht und an einen Bürgerschaftsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen wurde.[9] Ein ablehnendes Votum erfuhr der CDU-Antrag, der zwar auf das freiwillige Engagement in den bestehenden Beiräten abhebt, aber zusätzliche Gremien, gar gesetzlich verbrieft, strikt ablehnt.[10] Und schließlich ist der von allen Fraktionen (bei Enthaltung der LINKEN) angenommene SPD-Antrag zu nennen, der viele richtige, aber eben auch recht allgemeine Formulierungen zur Partizipation präsentiert und es in den entscheidenden Petita bei Berichtsersuchen und unverbindlichen Empfehlungen belässt.[11]
Was sich parlamentarisch in den vergangenen anderthalb Jahren hinsichtlich der Beiräte-Frage herauskristallisiert hat, ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere, noch viel wichtigere ist der nötige, weiter zu erhöhende Druck auf die etablierten Parteien in Bürgerschaft und Bezirksversammlungen. BürgerInnen-beteiligung, Partizipation usw. dürfen sich nicht in Allerweltsfloskeln erschöpfen, Metropolendemokratie im Allgemeinen und Stadtteildemokratie von unten kosten Geld und müssen belastbar abgesichert werden. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat in seinem »7. Wahlprüfstein: Stadtteilbeiräte verstetigen und weiter entwickeln« für die Hamburger Bezirksversammlungs-Wahlen am 25. Mai 2014 klare Duftmarken gesetzt: »Insbesondere die Stadteilbeiräte haben sich vielerorts bewährt, wenn sie ehrenamtliches Engagement und professionelle Kompetenz im Stadtteil erfolgreich miteinander ins Gespräch bringen konnten. Sie sind jedoch ohne die städtebaupolitische Förderkulisse des RISE nicht aufrecht zu erhalten. Deshalb sollten die Bezirke bzw. die Bezirksversammlungen in die Lage versetzt werden, Stadtteilbeiräte auch in eigener Zuständigkeit einzusetzen und finanziell auszustatten. Damit könnte nicht nur eine wichtige Weiterentwicklung kommunaler Demokratie ermöglicht werden, sondern auch ein wesentlicher sozialpolitischer Impuls zur sozialräumlichen Gestaltung der Stadtteile gesetzt werden. Die erfolgreiche Arbeit bestehender Stadtteilbeiräte darf aber nicht durch Stellenstreichungen der bezirklichen Gebietskoordinatoren gefährdet werden.«
Für DIE LINKE(n) mit ihrer »natürlichen« Nähe zu partizipativen Ansätzen und Modellen stellt die BürgerInnenbeteiligung, das »Mitreden – Entscheiden – Selbermachen« (so der Slogan des Beteiligungsforums am 9. Mai 2014 im Bürgerhaus Wilhelmsburg), stellen Quartiers- und Stadtteilbeiräte sicher ein wichtiges Feld der politischen Auseinandersetzung wie auch des persönlichen Engagements dar. In dieser Hinsicht ist die Linksfraktion in den nächsten Monaten gut beraten, wenn sie einerseits das Ringen um einen eigenen, auskömmlichen Haushaltsposten »Beirätearbeit« im neuen Doppelhaushalt 2015/2016 fortsetzt, andererseits auch geeignete Initiativen ergreift, die Quartiers- und Stadtteilbeiräte als eine noch weiter auszubauende Säule der Metropolen- und Stadtteildemokratie von unten gesetzlich zu verankern. Dafür bietet sich möglicherweise das Hamburgische Bezirksverwaltungsgesetz an, das im § 33 immerhin schon mal die »Beteiligung von Kindern und Jugendlichen« wenigstens in einem Satz unterstrichen hat: »Das Bezirksamt muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu entwickelt das Bezirksamt geeignete Verfahren.« Da wäre ja wohl noch deutlich mehr drin!
Und zuguterletzt sei noch eine rhetorische Frage gestellt, die Vision einer flächendeckenden, institutionalisierten Beteiligung auf Stadtteilebene betreffend: Was stände, aus fortschrittlicher Perspektive, Hamburg besser zu Gesicht? 12,5 Mio. Euro für den bereits erwähnten Neubau der bestehenden Mahatma-Gandhi-Brücke zur Elbphilharmonie oder diese Summe, mit der einige Jahre lang in allen 104 Stadtteilen gute, professionell begleitete und abgesicherte BürgerInnenbeteiligung finanziert werden könnte? Der SPD-Senat hat sich längst entschieden.
[1] Große Anfrage der Linksfraktion zur »Bürgerbeteiligung«, Bürgerschafts-Drs. 20/4846 vom 4.9.2012.
[2] Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Hrsg.): Hamburg gemeinsam gestalten. Bürgerbeteiligung und –information in der Stadtentwicklung. Hamburg, Oktober 2013. Siehe unter »Publikationen« auf der Website www.hamburg.de/bsu.
[3] Beide Netzwerke sind unabhängig voneinander im September 2009 entstanden. Im Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte kommen etwa zweimonatlich VertreterInnen von 15 bis 20 Beiratsgremien zusammen (zu einem guten Teil aus den peripher gelegenen Großwohnsiedlungen und Fördergebieten), im Netzwerk Recht auf Stadt allmonatlich AkteurInnen aus 15 bis 25 Gruppierungen (vorrangig aus den innenstadtnahen Quartieren).
[4] Beide Resolutionen finden sich im Anhang dieser Broschüre, S. 39-42.
[5] Antrag der Linksfraktion, Bürgerschafts-Drs. 20/6038 vom 29.11.2012. Das Dokument befindet sich im Anhang dieser Broschüre auf S. 37.
[6] Antrag der CDU-Fraktion: »Absicherung der ehrenamtlichen Arbeit in den Bezirken – Verstetigung der Arbeit der Stadtteilkonferenzen, -beiräte und -versammlungen«, Drs. 20/6065 vom 30.11.2012; Antrag der GRÜNEN-Fraktion: »Verstetigung der Stadtteibeiräte – Bürger-/-innen-Beteiligung verankern!«, Drs. 20/6104 vom 11.12.2012 (Neufassung).
[7] Antrag der SPD-Fraktion, Drs. 20/6154 vom 6.12.2012 (Neufassung).
[8] Antrag der Linksfraktion: »Die Quartiers- und Stadtteilbeiräte erhalten und verstetigen!«, Drs. 20/10230 vom 5.12.2013, s. Anhang, S 38f.
[9] Antrag der GRÜNEN: »Stadtteilarbeit vor Ort stärken – europäische Fördermittel nutzen«, Drs. 20/10432 vom 8.1.2014.
[10] Antrag der CDU: »Konzept für Zukunft des freiwilligen Engagements in Stadtteilbeiräten und vergleichbaren Gremien vorlegen«, Drs. 20/10587 vom 22.1.2014.
[11] Antrag der SPD: »Quartiers- und Stadtteilbeiräte sichern und weiterentwickeln«, Drs. 20/10584 vom 22.1.2014 (Neufassung).
Broschüre von Michael Joho über den Verleger Otto Carl Meissner, der ab 1856/57 bis zu seinem Tod 1902 in St. Georg gelebt und gearbeitet hat. Erschienen 2022.
Broschüre [pdf]
Artikel erschienen im "Lachenden Drachen" vom August 2022
Der Dank an Ricarda Wyrwol für die Schaffung der Gedenktafel (Foto: Christian Diesener)
Wie bereits im letzten „Lachenden Drachen“ kurz berichtet, ist am 2. Juli am Haus Danziger Straße 31 eine Gedenktafel für den hier ab 1861 ansässigen Verleger Otto Meissner (1819-1902) enthüllt worden. Geschaffen wurde sie im Auftrag der hiesigen Geschichtswerkstatt von der St. Georger Bildhauerin Ricarda Wyrwol. In Anwesenheit von rund 60 TeilnehmerInnen bildete dieser feierliche Akt den Schlusspunkt eines Projekts, das sich über fünf Jahre hinzog – von der ersten Idee einer solchen Würdigung Anfang September 2017 über Recherchen, erste Artikel, Veranstaltungen, Gipsentwürfe, Spendenakquise bis schließlich hin zum Bronzeguss und der Aufhängung im Juni 2022.
Ricarda Wyrwols Werkstatt in der Koppel (Foto: M. Joho)
Wer sich in den vergangenen Monaten in der Werkstatt von Ricarda Wyrwol umgeschaut hat, hat einen Eindruck davon bekommen, was es heißt, eine Gedenktafel herzustellen. Die erste Zeit ging dafür drauf, sich in die betreffende Person hineinzufühlen, Grundlage dafür war dafür das einzige bis dato bekannte Porträt von Otto Meissner. Da also wenig Fotomaterial und noch weniger persönliche Äußerungen vorliegen, hieß es, neben dem Porträt und den lebens- und Wohndaten Meissners insbesondere auch wenigstens einige verlegte Bücher ins Augenmerk zu rücken. Über den Schaffenprozess konnten sich Interessierte in zwei Besichtigungen am 2. Juli in Ricardas Werkstatt inspirieren lassen.
Negativ-Gips-Vorlage für den Bronzeguss
Ein absoluter Höhepunkt für Jürgen Bönig, Dominique Dahlmann und mich war dann am 20. Juni der Bronzeguss der von Ricarda als Gipsnegativ gelieferten Vorlage. Wir haben einen halben Tag diesem beeindruckenden Akt beigewohnt und uns die verschiedenen, sich über Tage hinziehenden Arbeitsgänge von der Künstlerin und den Gießerei-Experten in Elmenhorst erläutern lassen. Und waren mit Ricarda mordsgespannt, ob der Guss gelungen ist. Er war’s.
Bronzeguss der Gedenktafel bei 1200 Grad (Fotos: M. Joho)
Und am 2. Juli ist die Gedenktafel dann bei guter Beteiligung eingeweiht bzw. enthüllt worden. Nicht ohne, dass zuvor einige Reden gehalten wurden: von mir über die fünfjährige Vorgeschichte der Tafel, von Dr. Jürgen Bönig über die Bedeutung des neben Julius Campe wichtigsten Verlegers des 19. Jahrhunderts, von Dr. Susanne Pross und Angela Pokropp über die Familien- und Verlagsgeschichte sowie von Dr. Kay H. Kohlhepp über die Umbauten am Haus Danziger Straße 31. Abgerundet wurde das Ganze durch die Rezitation von Rolf Becker aus einigen der wichtigsten im Verlag erschienenen Werke.
Und am 2. Juli ist die Gedenktafel dann bei guter Beteiligung eingeweiht bzw. enthüllt worden. Nicht ohne, dass zuvor einige Reden gehalten wurden: von mir über die fünfjährige Vorgeschichte der Tafel, von Dr. Jürgen Bönig über die Bedeutung des neben Julius Campe wichtigsten Verlegers des 19. Jahrhunderts, von Dr. Susanne Pross und Angela Pokropp über die Familien- und Verlagsgeschichte sowie von Dr. Kay H. Kohlhepp über die Umbauten am Haus Danziger Straße 31. Abgerundet wurde das Ganze durch die Rezitation von Rolf Becker aus einigen der wichtigsten im Verlag erschienenen Werke.
Rund 60 TeilnehmerInnen am 2. Juli vor dem Haus Danziger Straße 31 (Foto: Christian Diesener)
Nun hängt die Gedenktafel also am Haus Danziger Straße 31. Und lädt ein zu einem Besuch der künstlerisch ansehnlichen und historisch-politisch wichtigen Gedenktafel zur Würdigung dieses bedeutenden St. Georgers. Und im Namen der Geschichtswerkstatt danke ich allen Spenderinnen und Spendern, allen voran Jürgen Bönig und nicht zuletzt der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte für die finanzielle Unterstützung bei diesem sehr aufwendigen Projekt. (mj)
Wir dokumentieren nachfolgend Auszüge aus einigen der gehaltenen Reden.
Aus der Ansprache von Michael Joho, des Vorsitzenden der Geschichtswerkstatt, der eingangs aus seiner Mail vom 1. September 2017 an die Redaktion des „Lachenden Drachen“ zitierte
Moin, ein weiterer Artikel für den DRACHEN ist sicher! Denn ich lese gerade, dass Otto Meissner einer von uns war, ein St. Georger!!! Wer war Otto Meissner? Der Verleger der Erstauflage des Marxschen Hauptwerks „Das Kapital“ vor 150 Jahren. Unglaublich, Vereinfacht gesagt, das bahnbrechende Werk wäre nicht herausgekommen, hätte es nicht Otto Meissner in St. Georg gegeben. Seit 1856 wohnte er vor Ort, also auch zum Zeitpunkt der Herausgabe des „blauen Bandes“ 1867. Da steht uns und der Geschichtswerkstatt bevor, eine Gedenkplatte anzubringen. Mehr dazu im DRACHEN. Michael, ganz aufgelöst.
Von links: Kay H. Kohlhepp (Hauseigentümer), Susanne Pross und Angela Pokropp (Ur-Ur-Enkelinnen), Ricarda Wyrwol, Jürgen Bönig und Michael Joho – es fehlt Rolf Becker, der nach seinem Beitrag zu einer anderen Veranstaltung eilen musste (Foto: Silke Koppermann)
Aus der Rede von Dr. Jürgen Bönig, Autor des Buches „Karl Marx in Hamburg“ und einer im Herbst erscheinenden Meissner-Biographie
In dem Haus, vor dem wir hier stehen – oder besser – dem Vorgängerbau – wohnte mit seiner Familie seit 1861 Otto Carl Meissner – Verleger des „Kapital“ von Karl Marx.
Aber der aus Quedlinburg stammende und in Magdeburg zur Schule gegangene Buchhändler und Verleger hat nicht nur den einzigen Band des „Kapital“ veröffentlicht, der zu Lebzeiten von Marx selber fertigstellt worden ist und dann die weiteren Bände mit Friedrich Engels herausgegeben, sondern auch die wichtige Broschüre „Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“ in Europa zugänglich gemacht, die den Begriff des Bonapartismus geprägt hat. Meissner hat als Buchhändler und Verleger sich fortwährend in politische Geschäfte eingemischt und unsere Stadt und dessen politisches Leben im 19. Jahrhundert mit geprägt. (…) Der Verlag Otto Meissners hat unsere Kenntnisse über die Welt in ökonomischer, politischer und historischer Hinsicht vermehrt, den Kampf gegen Diskriminierung insbesondere gegen den Antisemitismus befördert und durch Kenntnisse eine demokratisch kontrollierte Verwaltung in Staat und Gesellschaft betrieben. Otto Carl Meissner hat sich um die demokratische Verfasstheit des Hamburger Staates im umfassenden Sinne verdient gemacht – ohne dass Bürgerschaft, Senat und Gesellschaft in Hamburg das bis heute auch nur zur Kenntnis genommen haben.
Aus dem Grußwort von Dr. Susanne Pross, Nachfahrin
Als Ur-Ur-Enkelin von Carl Otto Meißner betrachte ich es als eine besondere Ehre, zu der heutigen Einweihung der Gedenktafel hier in Hamburg in der Gurlittstraße 31 eingeladen worden zu sein. Ich habe mit großem Interesse die Berichte über den Lebensweg und das verlegerische Lebenswerk unseres Vorfahren gehört und dabei für mich festgestellt, wie sehr sich doch sein lokalpatriotisches Interesse, sein soziales Engagement und die Liebe zu Hamburg auch in den nachfolgenden Generationen wiederfindet. (…) Für unser nächstes Familientreffen in Hamburg ist ein gemeinsamer Spaziergang in die Gurlittstraße 31 fest eingeplant. Und natürlich auch in die Bergstraße 26, wo, dank der Initiative von Herrn Beuermann
Deckblatt der 40seitigen Meissner-Broschüre
Pünktlich zum 2. Juli ist auch die Broschüre zu Meissner und St. Georg fertig geworden. Sie kann zum Preis von 3,- Euro im Stadtteilbüro (Hansaplatz 9) erworben werden.
Otto Meissner war neben Julius Campe der bedeutendste Hamburger Verleger des 19. Jahrhunderts, dem u. a. die Veröffentlichung des Marxschen Hauptwerks "Das Kapital" (1867) und viele weitere Werke und Hamburgensien (z. B. "Hamburg und seine Bauten", 1890) zu verdanken sind. Wir haben einige Informationen im folgenden PDF zusammengefasst.
Carl Bühring ist ein weithin vergessener Präsident des Arbeitervereins St. Georg 1848.
Eine biographische Skizze von Michael Joho anlässlich der Einweihung der privaten Carl-Bühring-Bibliothek am 12. Oktober 2019 in Hitzacker.
Im Rahmen des Antikriegstages fand am 1. September 2021 in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt St. Georg e. V. eine Lesung an der Außenalster statt, genauer gesagt am Gedenkstein an der großen Alsterwiese Schwanenwik.
Drei Namen sind auf diesem Stein zu lesen. Die ersten beiden sind Männer der Jahrgänge 1915 bzw. 1905 – der eine 28, der andere 38 Jahre alt. Der dritte ist Hans-Wolfgang Schopper, Jahrgang 1927, also 16 Jahre jung, Schüler der Oberschule für Jungen in der Armgartstraße. Sie starben auf der Flakinsel während der Operation Gomorrha, des Hamburger Feuersturms.
Sprache wie Gestaltung des Gedenksteins irritieren, da nichts auf den Ursprung, den historischen Hintergrund geschweige denn eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Kindern im 2. Weltkrieg hinweist. Für Deutschland fielen?
Dieser Frage wurde im Rahmen der abgehaltenen Lesung nachgegangen. Erläuternd wurden sechs Tafeln mit weiteren Informationen gegenüber dem Gedenkstein aufgehängt.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen sowohl den Lesungstext [pdf] als auch die Tafeln [pdf] zum Nachlesen anbieten.
Umfangreiche weiterführende Informationen finden Sie auf der Seite des »Netzwerks Erinnerungskultur im Bereich der Nordkirche«; sowohl zur Geschichte des Gedenksteins (Unterpunkt Uhlenhorst) als auch zu der von uns veranstalteten Lesung (Punkt 18).
The St. Georg quarter belongs to the district(-authority) “Hamburg-Mitte”. The quarter’s limits are in the northwest the outer Alster Lake, in the south and west the railway tracks. In the northeast the St. Georg hospital (used to be property of Hamburg, privatized 10 years ago) marks the border to the district Hamburg Nord. The hospital, named after Saint George and originally dating from the middle ages, became the namesake for the whole quarter.
St. Georg was originally situated outside the walls of Hamburg, it was integrated into the city of Hamburg only 1868, a date that marks the beginning of the first building boom. On 1.8 square Kilometres about 12.000 people are living here today, part of them in older cheap flats, but more and more in expensive owner occupied flats. The latter are either newly built or originate from luxury modernized older flats in houses from the 19. Century. Parts of the quarter nowadays are under monument protection.
More than 20.000 workplaces and more than 20.000 hotel beds, too, in and around St. Georg. That means you meet more employees or tourists than inhabitants here.
During the last 20 years, an increasing number of new houses have been built (and still are being built), that means a rise of the average rent in the quarter. Especially along the Lange Reihe owner occupied flats belong to the most expensive in Hamburg. St. Georg benefits of its excellent transport connections. Part from the main railway station (opened 1906) there are two other local transport stations inside the quarter. By means of this infrastructure, you can reach St. Georg with all underground- and suburban train lines. Furthermore, the Central Bus Station (ZOB) is situated on St. Georg grounds. After the liberalization of long distance bus traffic the number of long distance buses to and from all parts of Europe starting and ending in St. Georg has highly increased. Some parts of St. Georg still have to cope with a high crime rate, especially drug trafficking and illegal prostitution.
Main and central institutions like the house of the DGB (german federation of trade unions, since 1907), many advisory centres. Quite a lot of religious centres, too.
Many active citizens, organized in several registered associations, such as the Geschichtswerkstatt (historical workshop), Bürgerverein (citizen’s association) and Einwohnerverein (inhabitant’s association). Regular public participation since 1978, when the redesign around the „Lange Reihe“ began. St. Georg – because of its central position in the city of Hamburg – has to carry the burden of nearly all social problems you can think of, prostitution, drug trafficking, impoverished drug users, homeless people from other countries, youngsters having run away from home. However, the inhabitants always came to solutions for their living together, if necessary against the authorities, may be the district authority or the main administration of the city.
Used to be home of poor people, foreign guestworkers, refugees until the seventies of the last century. Buildings were not taken care of; there were many gaps between the houses where the bombs had destroyed buildings or parts of them. Some thought about demolishing and rebuilding St. Georg in a futuristic style.
In 1978, the enhancement began along the Lange Reihe, an architectural and social redesign was the aim of the city. Real property companies, from not only Hamburg or Germany, but all around Europe have begun to focus on the possible profits here. In German investors talk about “Betongold”, gold made of concrete.
HANSAPLATZ
The fountain dates from 1878, the sculptures represent historic persons such as Charlemagne, the upper sculpture „Hansa“ is an allegory of the Hanseatic League, trading cooperation of merchants from north German and Baltic cities in the middle ages). A redesign or renovation of the square was carried out by the city for two and a half million Euros some years ago. The aim was ousting of the homeless drunkards, partly migrants from southeastern Europe who like to stay on the square, for some people the crime of
loitering. And they wanted to get rid of the prostitution. A special invention of social democrats in Hamburg: prohibition of contact, fines for punters and prostitutes. The square should become attractive for tourists and of course, the new owners of the flats around the square did not want to see and hear the phenomena you can find on the wrong side of the tracks behind the main railway stations in any European city.
Vortrag auf dem Abschlussempfang des »Tages des offenen Denkmals 2017« im Musiksaal des Hamburger Gewerkschaftshauses am 10.9.2017
von Michael Joho, Geschichtswerkstatt St. Georg e.V.
Liebe Frau von Jagow, sehr geehrter Herr Senator Dr. Brosda, meine Damen und Herren!
Gleich vorweg: Meines Erachtens hätten wir diese Veranstaltung auch gerne im Cityhof, im Feldbunker oder in der Schiller-Oper durchführen können!
Ich freue mich aber auch besonders, dass der diesjährige Abschluss des Tages oder besser: der Tage des offenen Denkmals 2017 in St. Georg, im wiederhergerichteten Musiksaal des Gewerkschaftshauses, also einem vor allem sozial und politisch gekennzeichneten Ort, stattfindet. Nicht nur der Saal, der gesamte Gebäudekomplex rückt damit für einen kleinen Moment ins Bewusstsein einer größeren, über die gewerkschaftlichen Kreise hinaus gehenden Öffentlichkeit. Mehr als 150 TeilnehmerInnen waren es bei den Führungen durch das Gewerkschaftshaus heute Nachmittag. Mehr Sichtbarkeit, mehr Publikum kann dem Gewerkschaftshaus nur gut tun. Denn die Wahrnehmung heutzutage, gar die Frequentierung dieses historischen „Zukunftsstaats am Besenbinderhof“ („Hamburger Nachrichten“, 20.2.1909) ist doch eine grundlegend andere als vor einem Jahrhundert. Versetzen wir uns einige Minuten zurück, in die Zeit vor bzw. um 1900.
Der Besenbinderhof – schon im 17. Jahrhundert benannt nach einer bekannten Kneipe – war vor gut 100 Jahren noch eine vergleichsweise beschauliche Straße, mit zweiund dreigeschossigen Häuserchen, parallel verlaufend zur verkehrsreicheren Großen Allee. Bekanntester Bewohner – ehemals – war der Hamburger Ratsherr und Dichter Barthold Heinrich Brockes (1680-1747), der hier seinen Sommersitz mit prächtigem Barockgarten hatte, das „Irdische Vergnügen in Gott“ sozusagen. Dank Burchard Bösche und der Kunststiftung Heinrich Stegemann gibt es seit November 2016 eine Gedenktafel für Brockes gleich neben der Büchergilde.
Auf dem Besenbinderhof hatte aber auch 90 Jahre lang (bis 1907) das „Tivoli“ seinen Sitz, Hamburgs größtes Garten- und Vergnügungslokal mit einer legendären Rutschbahn den Geestabhang hinunter.
Überhaupt der Geestrücken, auf dem sich der Besenbinderhof befindet. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts – bis zur Lindley’schen Entwässerung und der Bebauung der Marschlandschaft des Hammerbrooks – hatte man von hier oben einen noch völlig unverstellten Blick bis zur Bille und Elbe. Für Brockes und andere Honoratioren der Stadt war genau das der Grund, an diesem Geestabhang im 17./18. Jahrhundert Sommerhäuser zu unterhalten.
Warum nun aber entstand hier 1906 das Gewerkschaftshaus? Vor allem, wenn man sich die heutige Lage vergegenwärtigt. Und sich das Gefühl nicht verkneifen kann, dass diese „geistige Waffenschmiede des Proletariats“ (so bekanntermaßen August Bebel am Tag der Einweihung am 29.12.1906) einen buchstäblich etwas verlorenen Eindruck macht:
Nach „vorne“ mein Stadtteil St. Georg, in dem heute rund 10.500 Menschen leben, inzwischen überlagert von mehr als 40.000 Büroarbeitsplätzen. Nach „hinten“ der Hammerbrook, der erst in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten bebaut und zu einer wenig ansehnlichen Bürostadt mit gerade mal 4.000 BewohnerInnen geworden ist, genannt die „City Süd“. Verlorenes Terrain, wie ich als St. Georger sagen muss!
Schauen wir aber ein gutes Jahrhundert – sagen wir, auf das Jahr 1900 – zurück, stellte sich die Lage ganz anders dar: Nach vorne St. Georg-Nord mit seinen fast 44.000 BewohnerInnen, ein vor der Eröffnung des Hauptbahnhofs am 6.12.1906 noch kleinbürgerlich dominiertes Mischviertel mit nur wenigen Arbeiterwohnstraßen.
Aber nach hinten lag mit St. Georg-Süd – wie der Stadtteil bis zum Groß-Hamburg-Gesetz 1937 noch hieß – das größte, nahezu homogene Proletarierquartier Hamburgs. 1900 lebten hier 53.000 Menschen, weit überwiegend aus einfachen Arbeiter- und Handwerkerhaushalten.
Das war das Milieu, in dem August Bebel (1840-1913) seine Stimmen bei den Reichstagswahlen bekam. Zwischen 1883 und 1893 und von 1898 bis zu seinem Tod 1913 wurde der legendäre Führer der deutschen Sozialdemokratie als Hamburger Abgeordneter entsandt. Im Wahlbezirk 41 (Hammerbrook und Süderstraße) bekam seine Partei 1890 sage und schreibe 94 % der Stimmen. Bezeichnenderweise führte die Süderstraße schon seit 1883 im Volksmund den Namen „Bebels Allee“.
Als das Gewerkschaftshaus 1906 seinen Betrieb aufnahm, hatte es also zumindest ein proletarisches Hinterland. Es stimmt mich bisweilen doppelt traurig, dass dieses im Juli/August 1943 im Bombenhagel des Unternehmens „Gomorrha“ unterging. So viel zu der heute vielleicht etwas seltsam anmutenden Standort des Gewerkschaftshauses, das zu einem Teil Opfer der veränderten topographischen Lage geworden ist und heute nicht gerade von Publikum überlaufen wird.
Aber das hat natürlich auch etwas mit dem veränderten Bewusstsein und Verhalten großer Teile der Bevölkerung zu tun. Wir sind hier im Erweiterungsbau des Gewerkschaftshauses von 1913, im historischen Musiksaal mit seinen 400 Plätzen (heute!). Schätzen Sie mal, wie viele Menschen am 29.12.1906 in den verschiedenen, miteinander verbundenen Sälen des gerade eingeweihten Altbaus Platz fanden: Nicht 1.000, nicht 2.000, 5.000 Menschen passten alleine in den Altbau, und noch einmal weitere 3.000 nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus 1913. Und seien Sie gewiss, dass das Haus öfters überfüllt war!
Karl Odenthal, einer der drei Geschäftsführer der 1904 gegründeten Gesellschaft Gewerkschaftshaus Hamburg GmbH schrieb 1924 über das „Heim der Hamburger Arbeiter“: „Man muss gesehen haben, wie das Leben im Hause vibriert. Ständiges Kommen und Gehen. Hunderte, Tausende besuchen am Tage ihre Organisationen. Das Treppenhaus ist an manchen Stunden des Tages für die Menschen zu eng. Viel Elend wird durch die Enge hinaufgeschleppt, auch viel Zufriedenheit herunter.“
Das Gewerkschaftshaus war damals etwas Anderes als heute, man mag sich das als eigenen Kosmos vorstellen. Es zog täglich Tausende an, hatte offenbar eine enorme
Anziehungskraft und erfüllte eben auch beträchtlich mehr bzw. heute nicht mehr vorhandene Funktionen. Und dies ab 1906 nicht nur in Hamburg – die Zahl der Gewerkschaftshäuser wuchs von ca. 15 um die Jahrhundertwende sprunghaft auf 80 bis 1914 an.
Schauen wir kurz auf die unmittelbare Vorgeschichte, die zum Hamburger Gewerkschaftshaus führte. Zunächst einmal erforderte das rapide Wachstum der Verbände nach Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890 schlicht neue Arbeits- und Büroräume. In Hamburg waren dabei nicht nur die rund 37.000 Mitglieder (1900) zu beraten und zu verwalten, hier hatten in den 1890er Jahren immerhin 25 von 57 gewerkschaftlichen Zentralverbänden ihren Sitz, darunter bis 1902 die „Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands“
Zum zweiten stand die Arbeiterbewegung mit ihrer geradezu explodierenden Organisationsvielfalt vor der Herausforderung, große Säle für Versammlungen, aber auch gesellige Treffpunkte zu schaffen. Hier und da ließ sich in großen Lokalitäten tagen, aber letztlich standen die Gastwirte vor der Entscheidung, entweder dem trinkfreudigen Militär oder den Arbeiterorganisationen den Vorrang einzuräumen. Beides zusammen ging nicht oder war seitens der Militärbehörden sogar untersagt. Eigene Versammlungsmöglichkeiten wie auch ein großes Arbeiterlokal zu haben, lag daher auf der Hand.
Ein dritter Aspekt ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten: das Phänomen reisender Gesellen und Arbeiter. 1893 waren es alleine 10.000, die in Hamburg zunächst ihre Gewerkschaft aufsuchten, um a) eine Reiseunterstützung zu bekommen, b) natürlich einen Tipp, wo es Arbeit gab, und c) eben auch eine Unterkunft. Eine Zentralherberge war daher bei den Überlegungen für ein Gewerkschaftshaus von Anbeginn mit in Betracht gezogen.
Die Geschichte der Umsetzung dieser Motive ist schnell erzählt: Bereits 1894 setzten die Hamburger Verbände vorübergehend eine Gewerkschaftshauskommission ein, die allerdings mangels ausreichender Mittel nichtlange Bestand hatte.
Doch erst 1900 gab es einen Beschluss, den Bau eines eigenen Hauses anzugehen und dafür dann auch einen Baufonds einzurichten. Der speiste sich tatsächlich aus den berühmten „Arbeitergroschen“, aus Beiträgen der Gewerkschaften, der SPD und weiterer sozialdemokratischer Organisationen.
1902 mietete das Gewerkschaftskartell dann vorläufig die Arbeiterkneipe „Lessinghalle“ am Gänsemarkt 35 an. Dazu weitere sechs Büroräume bei Bedarf und gegen Aufschlag ein größeres Clubzimmer.
1904 wurde dem Kartell dann das 2.300 qm große Grundstück Besenbinderhof 60-66 angeboten. Das Grundstück wurde erworben, durch Zukäufe bis 1912 auf insgesamt 4.390 qm erweitert.
Gleich anschließend – am 12.6.1904 – wurde die bereits erwähnte Gewerkschaftshaus Hamburg GmbH gegründet, bestehend aus Vertretern der Gewerkschaften, der SPD, des „Hamburger Echo“ sowie des Konsum-, Bau- und Sparvereins „Produktion“ eGmbH.
Im Gefolge der Ende 1904 erfolgten Ausschreibung für den Neubau eines Gewerkschaftshauses mit Büroräumen, Versammlungs- und Festsälen, Restaurants und Herberge wurden insgesamt 25 Entwürfe eingereicht. Wettbewerbssieger waren Heinrich Krug und Albert Krüger, deren beider Skizzen zu einem gemeinsamen Entwurf umgearbeitet werden sollten. Nach Konflikten zwischen den beiden Architekten blieb Heinrich Krug allerdings alleine übrig; er gilt daher als Erbauer des Gewerkschaftshauses.
Nach dem Abriss der Vorgängerbebauung – konkret wohl einer kleinen „Jalousie- & Holzspan-Tapeten-Fabrik“ – erfolgte der Baubeginn am 18.8.1905.
Insgesamt 1,5 Mio. Mark mussten aufgewendet werden, um das Grundstück zu erwerben und den Bau fertigzustellen. Bereits am 11.6.1906 war Richtfest, die Einweihung – wie o.a. – datiert vom 29.12.1906. Fast sieben Monate nach Einweihung des Bismarck-Denkmals (am 2.6.1906) und drei Wochen nach Eröffnung des Hauptbahnhofs (am 6.12.1906).
Der Stolz nicht nur der hamburgischen Arbeiterbewegung auf dieses Gebäude war überwältigend. Alleine der Umstand, dass es „keinerlei Arbeitsunfälle“ gegeben habe, unterstrich nach eigenem Verständnis die Überlegenheit der organisierten Arbeiterklasse, die im 20. Jahrhundert endlich die Früchte des jahrzehntelangen Ringens einfahren Würde... Bebel fasste dies in seiner Festansprache am 29.12.1906 u.a. in diese Worte: „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass neben dem Rathause und dem Zentralbahnhof als dritte bauliche Sehenswürdigkeit unser Gewerkschaftshaus zu nennen sei. Man wird jetzt Respekt haben vor dem Können der so viel verachteten Arbeiterklasse.“
Von bürgerlicher Seite wurde der Bau jedoch überwiegend kritisiert, kleingeschrieben oder gleich ganz ignoriert. Der Hamburger Kunstschriftsteller Paul Bröcker (1875-1948) beispielsweise erwies der Arbeiterschaft in seiner Schrift „Über Hamburgs neue Architektur“ (1908) zwar eine gewisse „Achtung vor der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“, kritisierte aber böse, dass „die ganze Front des Gewerkschaftshauses und sein Dach (…) eine einzige große Kulisse (sind), nur nicht aus Farbe auf Leinwand gepinselt, sondern aus teurem Material, das in dieser Art angewandt nichts mehr und nichts weniger als eine namenlose Verschwendung von Geld und Schweiß ist. So baut der Parvenu, der Emporkömmling, der Gernegroß: so baut einer, der zeigen will, dass er es auch so kann, wie die Leute, die er als Protzen und seine Feinde bekämpft.“
Parvenüs und Emporkömmlinge hin oder her, dem weiteren Aufstreben und Wachstum der Arbeiterbewegung hat dieses Genörgel keinen Abbruch getan.
Weitere Gebäudekomplexe kamen hinzu: ein neu errichtetes (inzwischen wieder abgerissenes) Hinterhaus 1908/09 und ein erworbenes dreigeschossiges Wohngebäude (rechts), das 1909/10 als „Hotel Gewerkschaftshaus“ diente, aber bereits 1911 zu Büroraum umgewidmet wurde. Vor allem aber entstand 1912/13 (links) vom Altbau für 1,3 Mio. Mark ein Erweiterungsbau nach den Plänen des Hamburger Architekten Wilhelm Schröder. Hamburgs Gewerkschaften zählten inzwischen fast 120.000 Mitglieder, mehr als dreimal so viele, wie ein gutes Jahrzehnt zuvor.
Für den neuen Trakt musste ein Teil des Altbaus abgerissen werden, um die beiden Gebäudeteile miteinander zu verbinden und das Restaurant nochmals zu vergrößern. Die versetzten Teile sind noch heute erkennbar, wenn man – sozusagen auf der Höhe des Treppenhauses – vom Alt- in den Neubau wechseln möchte. Was leider heute kaum möglich ist, weil die Verbindungen auf den Etagen – aus Sicherheitsgründen – verschlossen sind.
Am 3.10.1913 wurde das erweitere Gewerkschaftshaus eingeweiht, die Grundfläche hatte sich – wie bereits angemerkt – von ursprünglich 2.300 auf 4.390 qm nahezu verdoppelt. Entstanden war damit das damals größte Haus der deutschen Gewerkschaftsbewegung überhaupt. Und – laut Hamburger „Bau-Rundschau“ (von 1921) auch das schönste, mit wunderbaren Holzfriesen und -plastiken, mit den von den einzelnen Gewerken finanzierten Mosaikfenstern im Restaurant – Reste sind im 10. Stock des Altbaus zu bewundern – und schließlich dem Musiksaal , in dem wir uns heute Abend befinden. Bis 1977 blieb das im Wesentlichen auch der Gesamtzustand des Ensembles, von kleineren Eingriffen und den Weltkriegszerstörungen der beiden Turmhauben, des Daches und der oberen Etagen einmal abgesehen.
Um zusammenfassend die Vielfalt der Räumlichkeiten und der Nutzungen zu veranschaulichen, will ich noch einmal aufzählen, was dieser Komplex kurz vor dem Ersten Weltkrieg beherbergte: Versammlungsräume für bis zu 8.000 Personen, mehrere Gaststätten, 83 Büros, 23 (24?) örtliche Zahlstellen von Gewerkschaften, sechs Gauverwaltungen, drei Vorstände von Zentralverbänden, das Arbeitersekretariat, das Gewerkschaftskartell, die Rechnungsstelle der Volksfürsorge, die Bauarbeiterschutzkommission, die Verwaltung des Hauses, die Wohnung des Ökonomen, ein Krankenkassenbüro, einige Arbeitsnachweise, Anlaufstellen für Arbeitssuchende die Bibliothek samt Lesezimmer der Zentralkommission für das Arbeiterbildungswesen und eben den Musiksaal, in den damals noch 600 Personen durften (heute nur noch 399).
Und dieses Angebot fand auch – vorsichtig formuliert – die gebührende Nachfrage, weit über die Gewerkschaften im engeren Sinne hinaus. Der ASB wurde hier 1907 gegründet, die Freidenker bezogen hier im gleichen Jahr Quartier, 1918/19 hatte der Arbeiter- und Soldatenrat hier seinen Sitz, bald darauf kam die Volksbühne unter, 1920 der Gemeinnützige Bestattungsverein, später die Buchhandlung „Auer“ und das Kartell für Arbeiterbildung, Sport und Körperpflege Groß-Hamburg; 1922 tagte hier die Gründungsversammlung der BGFG, die Gewerkschaftstage des ADGB 1908 und 1928 fanden den nötigen Platz, 1923 die Kongresse der Sozialistischen Jugend-Internationale und der Sozialistischen Arbeiterinternationale, 1926 kam hier die Internationale der Arbeitersänger zusammen.
Ein Ende nahmen all diese Aktivitäten am 2. Mai 1933, als SA- und SS-Männer das Gewerkschaftshaus, die Volksfürsorge An der Alster und sämtliche anderen Gebäude der gewerkschaftsverbundenen Arbeiterbewegung in ganz Deutschland brutal besetzten. NSBO-Transparente wurden an diesem bitteren Tag aufgehängt, alle schwarz-rot-goldenen Fahnen verbrannt, wie auch ein großer Teil der Bibliothek am 30.5.1933 auf dem Lübeckertorfeld. Eine Gedenktafel am heutigen Haupteingang erinnert an dieses dramatische Ereignis.
Im Gebäude machte sich die Deutsche Arbeitsfront breit, bis der Nazi-Herrschaft im Mai 1945 ein Ende gesetzt wurde. Beim symbolischen Befreiungs- bzw. ReinigungsAkt am 14.9.1945 meißelte der Baugewerkschafts-Leiter, Paul Bebert, das aufgesetzte Zahnrad von der Wand des Hauses endlich wieder ab.
In den ersten Nachkriegsjahren und -jahrzehnten hat das Gewerkschaftshaus nur noch abgeschwächt an den früheren Besuchszahlen anknüpfen können. Die Zerstörung des proletarischen Hinterlandes, aber eben auch die allgemeinen Veränderungen in der Gesellschaft forderten ihren Tribut.
Immerhin, ein reger Theaterbetrieb setzte für viele Jahre neue Akzente, von den ersten Aufführungen des hier von 1945 bis 1949 untergebrachten Deutschen Schauspielhauses über das 1949 eröffnete Theater am Besenbinderhof von Kurt Collien bis hin zu den „haarigsten“ Aufführungen „in der Geschichte der Tonkunst“ (HA, 18./19.10.1969): dem Musical „Hair“ 1969.
Froh können wir sein, dass ein geplanter Abriss des Gewerkschaftshauses zugunsten eines „modernen Glasbaus“ nach mehrjähriger Debatte 1973 ad acta gelegt wurde. Froh können wir auch sein, dass nach der Ver.di-Gründung 2001 die Entscheidung fiel, die in der neuen Gewerkschaft aufgegangene DAG-Verwaltung vom Johannes-Brahms-Platz an den Besenbinderhof zu verlagern. Dadurch war die Fortführung des historischen Gewerkschaftshauses, dieser so bedeutsamen Wirkungsstätte der hamburgischen Gewerkschaften bis auf Weiteres gewährleistet. Und froh bin ich auch persönlich darüber, dass mit der Restaurierung des alten Musiksaales und seiner Einweihung am 23.11.2016 wenigstens ein großer Saal wieder hergerichtet worden ist. Er erinnert damit an die großen Traditionen, an die massenwirksamen Zeiten der ersten Jahrzehnte und den Stolz der Hamburger Arbeiterschaft auf ihren „Zukunftsstaat am Besenbinderhof“.
Michael Joho, 10.9.2017
Erinnerungsorte und –rituale auf dem Prüfstand
Tagung der Hamburger Geschichtswerkstätten am 7.11.2015
Rededisposition von Michael Joho, GW St. Georg
Demokratische Gedenkkultur entwickeln!
1. Verortung der Geschichtswerkstätten
2. Tendenzen und Lücken der Gedenkkultur
3. Geschichtswerkstätten und Gedenkkultur
4. Zusammenfassung
1. Verortung der Geschichtswerkstätten
Auseinandersetzung auf dem letzten GW-Plenum um die Beteiligung am Historikertag 2016:
+ Geschichtswerkstätten – ein Teil der arrivierten Geschichtswissenschaft?
+ Oder doch noch immer mit dem Ziel, wider den Stachel zu löcken?
Mein Plädoyer: Festhalten an den Ursprüngen und „Traditionen“ der GW-Bewegung seit den 1970ern:
+ Eine klare Verortung und – ja – auch Engagement auf/an der Seite der „einfachen Menschen“, der Normalos vor Ort.
+ Mit besonderer Bezugnahme auf die Lebensverhältnisse der Vielen…
+ …und mit geschärftem Blick auf die Ausgegrenzten, Benachteiligten, Verdrängten und Engagierten in der Vergangenheit und in der Gegenwart.
+ Nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch anders: Mobilisierung der Betroffenen für die eigene, die nahe Geschichte – und Einbettung in die größeren Zusammenhänge
Etwas polemisch: Nicht die Stadtteilgeschichte im Allgemeinen und eine Korona ausgebildeter, promovierter, arbeitsloser HistorikerInnen in den Geschichtswerkstätten ist der Impetus der GW-Idee, sondern vielmehr
a) die VerORTung von Geschichte und Menschen (Stadtteilbewusstsein),
b) der Blick „von unten“, wobei der im Laufe der Geschichte sicherlich Veränderungen unterliegt (Parteilichkeit))
c) die lokale Verknüpfung mit den demokratischen Initiativen und Bewegungen, populär gesagt: Global denken, lokal handeln (Stadtteilengagement)
Und so bette ich auch die Gedenkkultur ein. Doch zunächst zu jüngeren Tendenzen in der hamburgischen Gedenkkultur.
2. Tendenzen und Lücken der Gedenkkultur
Anders als die ehemalige Kultursenatorin Horokova 2001 meinte, war, ist und bleibt die Aufarbeitung der NS-Zeit und die Bewahrung des antifaschistischen Erbes zentrale Aufgabe und Herausforderung – für alle!
Viele Publikationen und eine ganze Phalanx an Gedenkstätten seit den 1970ern:
+ KZ-Gedenkstätte Neuengamme
+ Mehr als 80 weitere Mahnmale und Denkmäler
+ Knapp 5.000 Stolpersteine und eine beeindruckende Schriftenreihe der LZ für polit. Bildung
+ Aktuell die Gestaltung des Lohseplatzes, an dem auch endlich der vom NS deportierten Roma und Sinti gedacht wird (Einweihung Feb. 2015)
+ das Deserteursdenkmal nahe dem Dammtorbahnhof (Einweihung am 24.11.2015)
+ Doch noch immer nicht ohne Konflikte, z.B.
a) der „Zug der Erinnerung“ mit DB-Problemen (2009?),
b) der Kompromiss in Sachen Teilumbenennung der Hindenburgstraße in Otto-Wels-Straße (2013)
c) das Polizeimuseum und die Erinnerung an die Rolle Hamburger PolizistInnen beim Genozid in Galizien (eröffnet Feb. 2014)
NS-Zeit ist es wert, immer auch gesondert betrachtet zu werden, allemal in Zeiten des aufkeimenden Rechtsextremismus und der wieder anwachsenden Ausländer- und Flüchtlingsfeindlichkeit.
Nur kurz dazu, zwei Knackpunkte der Auseinandersetzung um die Erinnerungskultur sind dabei:
a) Die endgültige Anerkennung des 8. Mai als Tag der Befreiung – als gesetzlicher Feiertag,
b) die anhaltende Kontroverse um den Volkstrauertag als etwas kaschierende „Würdigung der verschiedenen Opfer von Krieg und Gewalt“ (die Bredel-Gesellschaft ist da sehr aktiv).
Mir geht’s jetzt aber vor allem um andere Akzente bei der Frage, was sich im Stadtbild – also neben Publikationen und Ausstellungen – an Gedenkkultur und Gedenkformen sehen und anfassen lässt.
In den letzten Jahren nach meiner Wahrnehmung verstärkte Bemühungen auch in diesen Bereichen:
+ Thematisch: Hamburg als Kolonialstadt (Publikationen, Rundgänge, Aufführungen, Tafeln, Ausstellungen; Erinnerung an Heiko Möhle)
+ Thematisch: Rolle und Namen von Frauen (Publikationen, Straßennamen, Straßentheater; aktiv Rita Bake, Beate Kiupel und Brigitta Huhnke)
+ Interkulturell: Verstärkte Beschäftigung mit den verschiedenen migrantischen Bevölkerungsgruppen (Publikationen, Rundgänge, Rundfahrten)
+ Gestalterisch: Nach Wandbildern im Hafen, zur Frauenarbeit usw. das Wandbild-Programm der Heinrich-Kaufmann-Stiftung zu bestimmten Ereignissen der Geschichte: Helmuth Hübener, LauensteinWaggonfabrik-Streik 1869; zuletzt zu den Sülzeunruhen 1919 am Haus der Verbraucherzentrale
+ Kulturell: Szenische Aufführungen am Ort des Geschehens (wie z.B. in der Speicherstadt oder im Wilhelmsburger Bunker) bis hin zu historisch-politischen Veranstaltungsreihen (GW St. Georg)
Doch es gibt nach wie vor große weiße Stellen wie diese:
+ Hexenverfolgung (Zauberer, Ketzer…) bis in die frühe Neuzeitund im Einzelfall auch weit darüber hinaus
+ Vormärz und 1848er-Revolution: Bis auf die Patriotische Gesellschaft und einige Publikationen gibt es wenig, was daran erinnert – warum kein
Denkmal am Steintorplatz (Lämmermarkt-Unruhen; Barrikade…)
+ Arbeiterbewegung: Hätten wir nicht das Gewerkschaftshaus, das Museum der Arbeit und die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, wäre da sehr wenig…
+ Lebensreformbewegung von ihren Anfängen im 19. Jahrhundert bis zu den alternativen Lebensformen im späten 20. Jahrhundert: Genossenschaften, vegetarische Lebensweise, Umweltbewusstsein, alternative Lebensformen – hier wären sicher auch neue Formen des Geund Nachdenkens zu entwickeln
+ Am deutlichsten wird das Vergessen-Machen für die größte revolutionäre Erhebung im 20. Jahrhundert: die Novemberrevolution 1918 (kaum Wissen, wenig Veranstaltungen, keine Rundgänge, kein Denkmal bis auf das von Fritz Schumacher für die Revolutionsgefallenen auf dem Ohlsdorfer Friedhof
+ Vielfache Themen der Weimarer Republik und immer noch der NSZeit: Hier sei nur auf die Hamburger Kämpfer für die spanische Republik 1936/39 hingewiesen.
+ Antifa-Bewegung im Frühjahr/Sommer 1945: Völlig in Vergessenheit geraten – warum keine Gedenktafel in einem damals zeitweilig übernommenen Großbetrieb?
+ Widerstand gegen die Remilitarisierung und Atombewaffnung sowie die Friedensbewegung der 1980er Jahre – mit einer Dauerausstellung in einer Kaserne oder im Rathaus, neben dem dortigen „Kreuzer Hamburg“?
+ Komplex Gastarbeiter, Ausländer, Einwanderer, Flüchtlinge – warum bisher kaum ein Platz oder eine Straße nach Menschen mit ausländischen Wurzeln benannt, die sich hier „verdient“ gemacht haben? Oder am Bieberhaus – dem ehemaligen Sitz der Ausländerbehörde – oder dem PK 11 – ehemals an der Kirchenallee gelegen – als Skandalwache, in dem Schwarzafrikaner misshandelt wurden?
+ Komplex Umwelt, Ökologie, Klimakatstrophe: Wieso heißt die Mülldeponie Georgswerder neuerdings Energieberg, statt Dioxinberg? Wo und wer erinnert im öffentlichen Bild die Auswirkungen der Umweltbelastungen?
+ Komplex Sanierung, Verdrängung, Gentrifizierung: Hier sind neben den unübersehbaren Erscheinungen der Aufwertung (schicke alte Häuser) vielleicht neue Formen des Erinnerns und Aufmerksam-Machens angebracht. Wo bleiben die ZeitzeugInnen-Gespräche, Dokumente der Verdrängten, die Gedenktafeln und Rundgänge? (immerhin St. Pauli, Ottensen und St. Georg sind da dran!)
3. Geschichtswerkstätten und Gedenkkultur
Die besondere Herausforderung der GWen: das Füllen der weißen Stellen im Sinne der alternativen, eingangs erwähnten humanistisch demokratischen Ziele
Der große Vorteil der GWen: die direkte Verknüpfung von historischen Ereignissen und Entwicklungen mit der nahen Umgebung, dem Quartier
Die große Chance der GWen: die Gewinnung und Mobilisierung von Menschen für ihr Quartier, die Schaffung von Stadtteilbewusstsein unddamit von Verantwortung für den eigenen Sozialraum
Werkstattbüros sind keine Elfenbeintürme oder reine Schreibstuben, dafür sorgen schon die Rundgänge („Kiek Mol“) und eine Reihe von begehbaren, anfassbaren Projekten wie z.B.
a) die Röhrenbunker der Werkstätten in Hamm und Eppendorf,
b) die Zwangsarbeiterbaracke der Wili-Bredel-Gesellschaft/GW Fuhlsbüttel
c) die Drahtstifte-Fabrik des Stadtteilarchivs Ottensen;
d) die Litfaßsäule der GW St. Georg am Carl-von-Ossietzky-Platz
Aber vielleicht ist auch noch mehr möglich als Publikationen,Rundgänge, Tafelprogramme (wie in Barmbek), Veranstaltungen und Archiv-Öffnungszeiten – das sind alles tendenziell Formen des Hinkommens und Konsumierens
Mein Wunsch: mehr interaktive Formen der Geschichtsarbeit, mehr
Austausch, breitere Angebote zum Mitmachen.
Denn eine demokratische Geschichtskultur von unten setzt m.E. nicht nur entsprechende inhaltliche Akzente, sondern versteht sich auch als Teil einer lebendigen, gestalterischen, kreativen, eingreifenden Stadtteilkultur.
In dieser Richtung weisen sicherlich:
+ Das Kinderprojekt des Stadtteilarchivs Bramfeld, das den MehrGenerationenaustausch im spielerischen Miteinander ermöglicht;
+ in gewisser Hinsicht auch der Bilderspeicher der Hamburger GWen, der vom Anschauen und eben auch Bringen historischer Fotos lebt – und da ist das Stadtteilarchiv Hamm ganz vorne;
+ ganz sicher die Erzählcafés, die es in verschiedenen Stadtteilen gibt, z.B. bei den Geschichtswerkstätten, aber auch bei den LABEinrichtungen, beim Seniorenbüro und der VHS;
+ die seit 20 Jahren realisierten, historisch-kulturellen Jahresprojekte der St. Georger Geschichtswerkstatt;
+ hier und da das Ringen um die Ein- oder Umbenennung von Straßen und Plätzen, die oft mit einer intensiven Auseinandersetzung einhergehen.
4. Zusammenfassung
Bei der Verbindung von Geschichte im Allgemeinen und der Verortung im eigenen Quartier, der Vermittlung von Stadtteilbewusstsein und Verantwortungsgefühl für die Gestaltung der eigenen Umgebung spielen die Geschichtswerkstätten eine wichtige Rolle.
Der können sie angesichts der mangelnden Finanzbasis in ganzer Breite nicht nachkommen – was angesichts der von Senatorin Horokova gekappten und seitdem mehr oder wenigher stagnierenden Finanzierung ein eigenes Kapitel wert wäre.
Dennoch, nachzudenken über die Weiterentwicklung und Ausfüllung der demokratischen Gedenkkultur lohnt immer.
Inhaltlich und methodisch:
a) Stadtteilgeschichte als Bestandteil des Stadtteilbewusstseins und -engagements verankern und dafür auch kooperieren mit den Stadtteilinitiativen und –gremien
b) Die eigene Parteilichkeit „von unten“ als Ausgangspunkt setzen,
c) weiße Flecken angehen,
d) an konkreten Orten und Persönlichkeiten veranschaulichen,
e) Spuren im öffentlichen Raum hinterlassen, öffentlichen Raum überhaupt als Ort der Betätigung verstehen
f) Menschen nicht nur als Gäste, Informations- und MaterialspenderInnen, sondern viel stärker als GestalterInnen und kreatives Potenzial begreifen.
Vortrag am 28.11.2007 im Gemeindehaus, Stiftstraße 15, aus Anlass des 100jährigen Bestehens des Gemeindehauses
von Michael Joho
0. Persönliche Vorbemerkung
1. Hamburg und St. Georg um 1900
2. Die Hamburger Kirche und die St. Georger Gemeinde um 1900
3. Das Gemeindehaus bis zu seiner Einweihung 1907
0. Persönliche Vorbemerkung
Der Titel der Veranstaltung ist natürlich eine etwas zugespitzte Formulierung, aber eine, die mir als Historiker – aufgewachsen in einem sozialdemokratischen Haushalt, die Jugendweihe durchlaufend – durchaus nahe ist. Dass Kirche und Arbeiterbewegung über weite Strecken Antipoden waren, birgt keine überraschende Erkenntnis. Betrachten wir nur einmal die Innere Mission einer Amalie Sieveking (1794-1859) und eines Johann Hinrich Wichern (1808-1881), die nicht zuletzt eine Reaktion auf die im Vormärz und in der 1848er-Revolution erstmals in Erscheinung getretene Arbeiterklasse gewesen ist. Ich zitiere beispielhaft Amalie Sieveking, die Gründerin und langjährige Vorsteherin der heutigen Amalie Sieveking-Stiftung, deren 175jähriges Bestehen wir vor kurzem im Stadtteil feiern konnten. Sie schrieb 1848 in einem so genannten „Sendschreiben“, laut Untertitel gerichtet an „die arbeitenden Classen in weiteren Kreisen, als ein Beitrag zur Beleuchtung der Arbeitsfrage, des Communismus u.s.w.“, folgenden Kernsatz: „Somit müssen wir denn doch aber auch wohl erkennen, daß der Unterschied zwischen Reich und Arm eben nothwendig hineingehört in die jetzige Weltordnung, in den Plan der göttlichen Vorsehung (...)“.1 So betrachtet, wären alle Aktivitäten der Arbeiterbewegung sinnlos gewesen, könnten alle demokratischen Initiativen der Jetztzeit ihr Engagement einstellen. Nachfolgend geht es allerdings um eine andere Etappe des Verhältnisses von Kirche und Arbeiterbewegung, die Zeit um 1900, auf die sich dieser Beitrag konzentriert. Es gilt zu beleuchten, wie der damalige Zusammenhang zwischen der sprichwörtlich „unkirchlichsten Stadt Deutschlands“ einerseits und der „Hauptstadt der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung“ andererseits beschaffen war und wie sich das insbesondere auf den Bau des 1907 eingeweihten St. Georger Gemeindehauses ausgewirkt hat.
1. Hamburg und St. Georg um 1900
Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die Stadt Hamburg sprunghaft an. Die Industrialisierung, der Seehandel und die Schaffung des Freihafens 1888 sorgten für einen enormen Arbeitskräftebedarf. Zehntausende von Menschen zogen in die Arbeit und Brot verheißende Elbmetropole, immer mehr Vororte wurden zu neuen Stadtteilen erklärt. Die städtische Bevölkerung wuchs alleine zwischen 1880 und 1910 von 410.000 auf 931.000 an,2 um kurz vor dem ersten Weltkrieg, die Millionengrenze zu überschreiten. Diese Entwicklung machten in Europa im 19. Jahrhundert quasi alle der heutigen Metropolen durch.
Riesige Menschenströme ergossen sich tagein, tagaus in die innerstädtischen Bezirke und den Hafen, weil hier der überwiegende Teil der Arbeitsplätze angesiedelt wurde. Alleine für den Bau der Speicherstadt in den 1880er Jahren mussten rund 20.000 Menschen ihr Domizil verlassen; sie fanden eine neue Bleibe in den schnell anwachsenden Proletarierquartieren wie Barmbek, Rothenburgsort, Eimsbüttel und Hammerbrook, dem damaligen St. Georg-Süd. Auch die Altund die Neustadt veränderten radikal ihr Gesicht. Im Gefolge der Choleraepidemie von 1892 wurden die alten Gängeviertel – ab 1900 in der Neustadt und ab 1905 in der Altstadt – nach und nach abgerissen; an ihre Stelle traten Kontore und ein neues Geschäftsviertel. Mit der Schaffung der Mönckebergstraße 1908 bis 1911 fand die Citybildung ihren vorläufigen Höhepunkt. Dementsprechend verringerte sich die Wohnbevölkerung in der Altstadt zwischen 1880 und 1910 von 77.000 auf 30.000.3 Heute ist die Innenstadt weitestgehend entvölkert und abends bekanntlich ein „totes Pflaster“.
Um die nun zunehmend an die Peripherie verzogenen Menschen zu ihren Arbeitsplätzen zu bringen, musste das öffentliche Verkehrssystem massiv ausgebaut werden. Ende 1906 wurden die verschiedenen, auf St. Georger Boden gelegenen Bahnhöfe im neuen „Centralbahnhof“ zusammengeführt, ab 1912 sorgte die „Ringbahn“ bzw. spätere U-Bahn dafür, die Arbeiterwohnbezirke mit der Innenstadt und dem Hafen zu verbinden.
Das citynahe St. Georg mauserte sich um die Jahrhundertwende zum Verkehrsknotenpunkt der Stadt Hamburg. Hier – d. h. im damaligen St. Georg-Nord und St. Georg-Süd – war die Bevölkerung zwischen 1880 und 1910 von 60.000 auf 104.000 angewachsen,4 davon etwa zwei Fünftel in unserem heutigen Stadtteil St. Georg und drei Fünftel im Hammerbrook und Klostertor. Um diese enormen Menschenmassen unterzubringen, entstanden auf dem gesamten Hammerbrook die berüchtigten proletarischen „Mietskasernen“, wie wir sie heute nur noch in Rudimenten aus Berlin kennen. St. Georg-Nord dagegen wurde von einer Welle von spät-gründerzeitlichen, meist fünfgeschossigen Wohnhäusern überzogen. Insbesondere der etwa einen Kilometer lange Steindamm erlebte in den späten 1890er Jahren den Wandel von einer noch von Fachwerkhäusern gesäumten Straße zur wichtigsten Wohn-, Einkaufs- und Flaniermeile des Viertels. Wir können von diesen Entwicklungen heute nicht mehr allzu viel sehen, weil der Hammerbrook im Feuersturm 1943 zu über 90 % und der Steindamm zwischen dem Kreuzweg und dem Lübeckertor komplett zerstört wurden.
Das Hineinreißen der ehemaligen Vorstadt St. Georg (bis 1868) in die neue Ära lässt sich symbolisch am Hauptbahnhofbau illustrieren. Bis in die 1890er Jahre hinein war St. Georg von den innerstädtischen Quartieren durch den alten Wallgraben abgetrennt. Er wurde dann mit Blick auf den Hauptbahnhofbau entwässert, aber nicht zugeschüttet, um in der um 1900 verbreiterten Mulde die Gleise der neuen Eisenbahnlinien zu verlegen. Damit war St. Georg nun gleich in mehrfacher Hinsicht an die Innenstadt „angebunden“, und insbesondere die ehemals verträumte Kirchenallee erlebte den zweifelhaften Aufstieg zum Theater- und Hotelstandort samt dem sich dahinter entfaltenden, so genannten „Vergnügungsgewerbe“.
Noch in einer anderen Hinsicht rückte St. Georg in den Fokus der Öffentlichkeit. Spätestens seit dem 1890 ausgelaufenen Sozialistengesetz galt Hamburg als Hauptstadt der deutschen Gewerkschaftsbewegung.5 Etliche Organisationen hatten hier ihre Zentrale, vor allem die ab den 1890er Jahren im Aufschwung begriffene Genossenschaftsbewegung war über verschiedene Bauten direkt mit St. Georg verbunden, wie auch der bis 1900 in der Koppel ansässige Zentralsitz des Dachverbandes der deutschen Gewerkschaften unter Carl Legien (1861-1920). Und schließlich entstand am Besenbinderhof 1904/06 eines der größten Gewerkschaftshäuser Deutschlands. Regelmäßig kamen darin Tausende von Menschen zusammen, um an Versammlungen teilzunehmen, Arbeitermusik-, -sportund sonstigen Darbietungen beizuwohnen, die Beratungseinrichtungen aufzusuchen, die Herberge in Anspruch zu nehmen oder in der größten Gaststätte Hamburgs das legendäre Hamburger Eisbein mit Sauerkraut und Erbsenpüree zu verspeisen. Als neuer Massenanziehungspunkt strahlte das Gewerkschaftshauses vor allem nach Hammerbrook mit seiner nahezu homogenen Arbeiterbevölkerung aus. Hier hatte der Sozialdemokrat August Bebel (1840-1913) schon in den 1890er Jahren in einigen Straßenzügen bis zu 94prozentige Wahlerfolge bei Reichstagswahlen einfahren können. Dem mittelständisch geprägten St. GeorgNord dagegen dürfte die von Bebel so titulierte „geistige Waffenschmiede des Proletariats“ dagegen eher als Fremdkörper erschienen sein...
2. Die Hamburger Kirche und die St. Georger Gemeinde um 1900
Um diese Veränderungen nun auf die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Georg zu beziehen, sei auch ein kurzer Blick auf die Hamburger Landeskirche um die Jahrhundertwende geworfen. „Die Leitung der Kirche“, schreibt Martin Hennig, „wurde genauso wie die des Staates von dem nach Hamburg einsetzenden Strom ortsfremder Menschen einfach überrannt. Das geschah um so nachhaltiger, als in Hamburg die Verhältnisse durch Jahrhunderte überschaubar geblieben waren, städtische und kirchliche Verwaltung im ganzen Hand in Hand gearbeitet hatten und die Mitarbeit in beiden Gremien im allgemeinen als Verpflichtung gefühlt wurde.“6
Immerhin zwischen 91 und 96 % der Gesamtbevölkerung waren 1906 noch Mitglied in einem der vier Kreise der ev.-luth. Landeskirche, rund ein halber Prozentpunkt weniger als im Jahre 1900. St. Georg hatte in diesem Zeitraum am meisten Mitglieder verloren, einmal absolut, weil sich 1900/1901 die Gemeinde Borgfelde abgetrennt hatte, aber auch relativ, war der Anteil doch um fast 2,8 % in der Bevölkerung zurückgegangen.7 Auf Grund des Bevölkerungswachstums entstanden zwischen 1880 und 1918 im Zuständigkeitsbereich der Landeskirche insgesamt 19 neue Gemeinden mit eigenen Kirchgebäuden, die Zahl der Pastoren verdoppelte sich von 1890 bis 1925 von 63 auf 120.8 Zu diesen neuen Gemeinden zählte auch Hammerbrook, also St. Georg-Süd, das Anfang 1887 zum Kirchspiel St. Katharinen dazugeschlagen wurde und 1901 mit „St. Anna in St. Catharinen“ eine eigene Kirche erhielt.9
Das enorme Wachstum der Bevölkerung machte den Pastorenmangel zu einem permanenten Problem. Für St. Georg-Nord bedeutete das z.B., dass 1895 auf einen Pastor über 18.000 Gemeindemitglieder kamen.10 Man muss sich die daraus resultierenden, konkreten Belastungen vor Augen führen: So hatten die drei St. Georger Pastoren Dr. Alexander Detmer (1814-1903; Pastor in St. Georg 1856-1903), sein Sohn Oskar Alexander Detmer (1851-1918; 1885-1918) und Alfred Kappesser (1869-1932; 1901-1932)11 beispielsweise im Jahre 1902 allein 606 Konfirmierte zu betreuen,12 d.h. im Durchschnitt 200! Aus Kirchenkreisen in ganz Hamburg kam daher die Forderung auf, dass auf jeden Pastor maximal 10.000 Gemeindeangehörige kommen sollten.
Innerhalb der Landeskirche rangen die Anhänger vor allem zweier Grundpositionen um Einfluss in den Vorständen. Unversöhnlich standen sich noch bis in die 1920er Jahre die so genannten „Liberalen“ auf der einen und die „Positiven“ auf der anderen Seite gegenüber. Erstere sahen sich in der Nachfolge der Aufklärung, zweitere Gruppierung verstand sich als Vertreterin orthodoxer Auffassungen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die hamburgischen Kapellengemeinden, darunter in St. Georg seit 1862 die Stiftskirchengemeinde mit ihrer Kirche und einem Gemeindehaus in der Stiftstraße, auf Grund ähnlicher antirationalistischer Auffassungen eher zu den „Positiven“ tendierten. Wie scharf die Auseinandersetzung bisweilen geführt wurde, zeigte sich exemplarisch in Eilbek. Dort stifteten drei Mäzene – darunter Dr. Mary Sieveking, geb. Merck (1835-1907), langjährige Vorsteherin der Amalie Sieveking-Stiftung von 1889 bis 1897 – im Jahre 1888 wohl das erste Hamburger Gemeindehaus. In einem Regulativ erteilten sie der Anbindung an den Eilbeker Kirchenvorstand und damit de facto an allzu „liberale“ Vertreter aus der Gemeindehausverwaltung eine Absage, „da bekanntlich leider unsere landeskirchlichen Gemeinden nicht davor gesichert sind, ungläubige Pastoren und Kirchenvorstände zu haben.“13
Auch in St. Georg tobten die Auseinandersetzungen um die theologischpolitische Ausrichtung. Da machte z.B. Karl Reimers, Herausgeber des „Hamburgischen Kirchenblattes“ und Pastor an der Hauptkirche St. Michaelis – einer Hochburg der „Positiven“ –, im Juli 1904 süffisant darauf aufmerksam, dass bei einem Umbau in den Kirchturmknopf der Dreieinigkeitskirche u.a. auch eine Ausgabe des sozialdemokratischen „Hamburger Echos“ gelegt worden sei. Und er zitierte die auswärtige „Frankfurter Zeitung“ mit diesen ironischen Worten: „Der Hamburger Kirchturm wird somit den späteren Geschlechtern künden, daß Kirche und Sozialdemokratie sich im Jahre des Heils 1904 bereits friedlich miteinander vertrugen.“14
Nein, die St. Georger Gemeinde stand damals keineswegs im Ruf einer roten Zelle. Aber hier hatte die „liberale“ Richtung schon seit längerem eine Bastion errichtet. Nachdem Alexander Detmer nach 47jähriger Pastorentätigkeit 1903 verstorben war, wurde Hans Gustav Ladendorf (1870-1948) berufen. Er war zuvor Pastor am Allgemeinen Krankenhaus gewesen und übte seine Tätigkeit in der St. Georger Gemeinde von 1904 bis 1932 aus.15 Allerdings zog sich seine Anerkennung einige Monate hin, weil Ladendorf als Mitglied des „Deutschen Protestantenvereins“ – eines Vorreiters der „liberalen“ Christen16 – offenbar auf Vorbehalte bei den Orthodoxen stieß, wie das „Hamburger Fremdenblatt“ im Gefolge einer kurzen Notiz im „Hamburgischen Kirchenblatt“ meldete. „Wir wissen nicht,“ schreibt Pastor Reimers, „wie man das aus unserer rein referierenden Meldung schließen kann. Aber es stimmt natürlich. Wie sollte uns auf der Kanzel Rautenbergs ein Mitglied des Protestantenvereins genehm sein! Da aber überhaupt ein Positiver nicht in Betracht kommt oder kommen wird, haben wir nicht die geringste Ursache, den Gewählten weniger zu wünschen als irgend einen anderen der Präsentierten“.17
Nach zwei „liberal“ dominierten Kirchenvorständen ging es im November 1906 auf eine Neuwahl zu. In diesem Zusammenhang erschienen gleich mehrere Flugblätter, in denen die gegensätzlichen Parteien Stellung bezogen und für ihre Sache agitierten. Es gehört zu den Besonderheiten der damaligen Zeit, dass sich maßgeblich die Bürgervereine in die Debatte einbrachten. Sie waren in ganz Hamburg meist in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gegründet worden, um nicht nur die mittelständischen Interessen zu vertreten, sondern insbesondere auch Kandidaten für die Bürgerschaftswahlen aufzustellen und eben die Kirchenvorstände entsprechend zu beschicken.18 Die drei damals in St. Georg aktiven und zutiefst antisozialistischen Bürgervereine von 1874, 1880 und 1886 unterstützen eine rein „liberale“ Liste für den zu wählenden neuen Kirchenvorstand. In einem gemeinsamen Pamphlet gaben sie folgende Stellungnahme ab: „Auch bei dieser Wahl wird ein schwerer Kampf entbrennen, und es ist daher geboten, alle Truppen ins Feld zu führen, wenn man es nicht dahin kommen lassen will, daß die Männer, die den Buchstaben über den Geist des Evangeliums setzen, den Sieg davontragen und einen entscheidenden Einfluß auf die Leitung der Kirche gewinnen, die so lange ein Hort des kirchlichen Freisinns gewesen ist.“19 Die Gegenposition nahm ein so genanntes „Spezialkomitee für positive Kirchenvorsteherwahlen“ ein. Und erstmals trat, allerdings anonym, eine neue Gruppe unter dem Namen „Einige Freunde der St. Georger Kirche“ in Erscheinung, die „in dem gehässigen Kampfe kirchlicher Parteien den Tod eines gesunden Gemeindelebens“ zu erblicken glaubte.20 Gewählt wurde schließlich die Liste der Bürgervereine, die letztlich auch einen „Positiven“ umfasste. Zu den zwölf neuen Vorstehern gehörte u.a. auch Johannes Gittermann, Vorsitzender des 1880er-Bürgervereins zwischen 1902 und 1910 und liberaler Bürgerschaftsabgeordneter von 1901 bis 1907.21
Die Wahlen zum Kirchenvorstand waren das eine, die aktive Beteiligung der Gemeindemitglieder etwas Anderes. Schon damals blieben viele Bänke in den protestantischen Kirchen Hamburgs am Sonntag leer. Vielleicht 20.000, schätzte Reimers, waren es, die sich regelmäßig in den Gotteshäusern einfanden, also nur ca. zwei bis drei Prozent der Kirchenmitglieder.22 Tatsächlich befand sich die Kirche um die Jahrhundertwende in der Krise, übrigens in ganz Deutschland.
Und die rückläufige Entwicklung der Kirchgänger kann dafür als ein Indiz herhalten. „Zu den Ursachen“, analysiert der Historiker Rainer Hering, „gehörte
u.a. die Pluralisierung der Lebenswelt, die die soziale Kontrolle geringer werden
ließ. So trug beispielsweise der Ausbau des Verkehrsnetzes dazu bei, daß am
Samstagabend Tanz- und andere Vergnügungen eher erreichbar waren, was zu
Lasten des Kirchenbesuchs am Sonntagmorgen ging. Im allgemeinen gingen
durch das Vordringen von Technik und Medizin auch wichtige sinnstiftende Erklärungsfunktionen der Kirche verloren.“23 Mindestens ebenso bedeutsam aber
erscheinen weitere Aspekte, auf die Victoria Overlack hinweist. Sie konstatiert
einerseits, dass die Kirche im Zuge der gesellschaftlichen Umbrüche „ihren festen Platz im rituellen Tages-, Wochen- und Jahreslauf“ verloren hätte. Andererseits habe die Kirche gerade durch „die Herausbildung alternativer Weltanschauungen auch auf ideellem Sektor“ an Einfluss und Anziehungskraft verloren.24
Gemeint ist damit natürlich die Arbeiterbewegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen geradezu kometenhaften Aufstieg erlebte und sich bis zur Jahrhundertwende nicht nur einen von Zehntausenden alleine in Hamburg getragenen Partei-, Gewerkschafts- und Genossenschaftsapparat, sondern auch das Organisationsgeflecht einer kompletten zweiten Kultur schaffen konnte. Nehmen wir beispielhaft dafür die Arbeitersportbewegung, die sich von der bürgerlich-nationalistischen „Deutschen Turnerschaft“ ablöste und in Hamburg mit dem „Vorwärts“ 1893 zu einer ersten Vereinsgründung kam. Da den Arbeitersportlern während der Kaiserzeit öffentliche Schulturnhallen verwehrt wurden, sah sich dieser Verein genötigt, das „Englische Tivoli“ an der Kirchenallee – dort steht heute das Deutsche Schauspielhaus – zum ersten Turnlokal des Hamburger Arbeitersports zu machen. 1913 konnte dann ein anderer Verein – die „Freie Turnerschaft Hammerbrook-Rothenburgsort“ – eine erste, selbst finanzierte Halle einweihen.25
Die hinsichtlich der Mitgliederzahlen und Wahlerfolge um 1900 sichtbar stärker werdende Arbeiterbewegung drohte aus Sicht der Kirche, dieser zunehmend den Rang abzulaufen. In einer Zeit der allgemeinen Entkirchlichung musste die zumindest von der Theorie her überwiegend atheistisch daher kommende Arbeiterbewegung als größte Herausforderung empfunden werden. Was war von einer Partei zu halten, in deren Reichstagsfraktion von 40 Abgeordneten 25 angaben, konfessionslos oder freireligiös, also lt. „Hamburgischem Kirchenblatt“ „Dissidenten“ zu sein?26 Etliche Artikel in diesem wichtigsten kirchlichen Periodikum sind der Sozialdemokratie und den freien Gewerkschaften, aber natürlich auch der vermeintlichen Alternative, den in den 1890er Jahren gebildeten christlichen Gewerkschaften gewidmet. Sie schlossen sich 1901 zum interkonfessionellen, allerdings katholisch dominierten „Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands“ zusammen,27 erreichten aber nie auch nur annähernd die Bedeutung ihrer mehr oder weniger sozialdemokratischen Konkurrenz. 1928 z.B. gehörten den freien Gewerkschaften fast 4,9 Millionen Mitglieder an, den christlichen nur 760.000.28
Vor diesem Hintergrund erweckte das neue Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof beim Herausgeber des „Hamburgischen Kirchenblatts“ natürlich besonderes Interesse, würde es doch bekunden, „wie fest die Masse der Unternehmer dieses Baues mit dem Gewerkschaftsgedanken verbunden sind. Es ist die Scheidung ist vollzogen. Das Gewerkschaftshaus ist nicht zuerst für die Propaganda gebaut, vielmehr von solchen und für solche, deren ‚Glaube’ der sozialistische Gewerkschaftsgedanke bereits ist.“29 Hier kam die von der Arbeiterbewegung ausstrahlende Gefahr zum Ausdruck: ein neuer Glaube, der der Schaffung des Paradieses auf Erden verbunden war! Und mehr noch: Die Arbeiterbewegung schickte sich an, die ehemals der Kirche vorbehaltene Rundumversorgung „von der Wiege bis zur Bahre“ mittels ihres Organisationsgeflechtes zu übernehmen. Doch noch standen die Zeichen in der Hamburgischen Landeskirche nicht wirklich auf Sturm, gehörten ihr doch unverändert weit mehr als 90 % der Bevölkerung an. Aber es gab ein Gespür für den Wandel, und konkret warnte beispielsweise ein Kirchenblatt-Artikel 1906 vor einer drohenden „Austrittsbewegung“, hatten doch in Berlin in diesem Jahr 50.000 Personen, überwiegend wohl aus der Arbeiterschaft, der Kirche den Rücken gekehrt.30
„Die alte Wahrheit, daß Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhält“, schreibt Reimers 1906, „verpflichtet ohne weiteres diejenigen, welche unser Volk beim Evangelium erhalten oder es für dieses zurückgewinnen möchten, auf die Entwickelung der sozialen Dinge Acht zu geben.“31 Eingedenk dieser Erkenntnis, wurden in Hamburg von kirchlicher Seite daher Bemühungen unternommen, sich verstärkt im Arbeitermilieu zu engagieren. Der vielleicht bekannteste Vertreter war der Theologe und spätere Oberlehrer Walther Classen (1874- 1954), der mitten im Proletarierquartier 1901 das erste Hamburger „Volksheim“ eröffnete. Dieser Anlaufpunkt für die Arbeiterjugend sollte als Gegengewicht zur Sozialdemokratie christlich-sozial inspirierte Arbeit leisten: Kurse, Vorträge, Theaterbesuche, Ausflüge etc. „Meine Arbeit galt zwar kaum für kirchlich“, notierte Classen 1932 in seinen Memoiren, „Ich hielt keine Andachten, keine Bibelauslegung; ich lebte nur mit den Jungen zusammen.“32 Und das war mehr, als von kirchlicher Seite damals üblich! Doch auch im Volksheim in der Sachsenstraße tobten die Auseinandersetzungen. Als Classen z.B. 1914, kurz nach dem Kriegsausbruch, vom Senat aufgefordert wurde, vormilitärische „Jugendkompagnien“ zu bilden und antimilitaristische Kritiker deswegen „in Schutzhaft“ genommen wurden,33 ging ein massiver Protest durch breite Teile der Arbeiterjugend. Bemühungen, sich aus dem gewohnten bürgerlichen Milieu der Gemeinden auf die Arbeiterschaft zuzubewegen und diese der Arbeiterbewegung abspenstig zu machen, blieben letztlich immer von begrenztem Erfolg.
3. Das Gemeindehaus bis zu seiner Einweihung 1907
Bei der Schaffung von Gemeindehäusern lag die Angelegenheit etwas komplizierter, wie schon der Eilbeker Fall 1888 gezeigt hatte, spielten damals doch auch innerkirchliche Konflikte eine Rolle – und ganz sicher auch Überlegungen zur der Neuorientierung als Großstadtkirche in einer Zeit der zunehmenden Säkularisierung. Viele Gemeinden gingen nach der Jahrhundertwende dazu über, meist neben den Kirchen gelegene Gemeindehäuser zu errichten, eine Entwicklung, die in ganz Deutschland ablief und alsbald zu einer Anzahl von Veröffentlichungen über die Ausstattung und das Angebotsprofil führte.34. Theodor Schäfer, Direktor der Diakonissenanstalt im damals noch preußischen Altona, schrieb 1905 zur Bedeutung solcher Einrichtungen: „Ein Gemeindehaus ist das einer evangelischen Kirchengemeinde gehörige Gebäude resp. ein Gebäudekomplex,
in welchem sie, mit Ausnahme der offiziellen Gottesdienste, alle ihre Arbeiten und Betätigungen, namentlich ihre Liebesarbeit treibt.“35 Dass es sich bisweilen auch ein wenig anders darstellte, zeigt nicht das Beispiel Eilbek.
Was grundsätzlich zur Planung von immer mehr Gemeindehäusern in Hamburg beigetragen hat, lässt sich einer Ansprache entnehmen, die Bürgermeister Dr. Johann Georg Mönckeberg (1839-1908) anlässlich der Eröffnung eines solchen Gebäudes in Harvestehude 1908 gehalten hat. Einleitend stellte er fest, dass nur ein kleiner Teil der Gemeindemitglieder in Harvestehude an den Gottesdiensten teilnehme und von einem Gemeindeleben nur in einem sehr geringem Maße die Rede sein könne. Die weiteren Ausführungen seien hier ausnahmsweise einmal länger zitiert, gelten sie doch im Grunde für alle damaligen Unternehmungen
dieser Art.
„Es hat sich (...) hier wie in vielen anderen Kirchspielen Hamburgs das Bedürfnis geltend gemacht, nicht nur durch die gottesdienstlichen Handlungen in der
Kirche, sondern auch auf andere Weise für die Förderung christlichen Gemeindelebens zu wirken. Sie wissen, auf wie mancherlei Weise diese Bestrebungen abseiten der Herren Pastoren gefördert wurden, durch Missions- und Bibelstunden, Männer- und Frauen-, Jünglings- und Jungfrauen-Vereine, christliche Armen und Krankenpflege, Verbreitung christlicher Schriften, Kindergottesdienste und vieles andere. Alle diese Bestrebungen sollen schließlich dazu dienen, ein christliches Gemeindeleben zu fördern, die Gemeinde um Kirche und Pfarramt zu sammeln. Es sind namentlich zwei Grundgedanken, die all diesen Bestrebungen zugrunde liegen: Erstens das Verhältnis der Pastoren zu den Gemeindegliedern zu beleben und vielseitig auszugestalten, dem Pastor Gelegenheit zu geben, auch mit solchen Kreisen in Berührung zu kommen, die sich im allgemeinen nicht zur Kirche halten, um durch solchen Verkehr dieselben zur Kirche heranzuziehen. Zweitens aber gilt es, ein Verhältnis zwischen den Gemeindegliedern untereinander zu schaffen. Wie kann ein Gemeindeleben bestehen, wenn die Mitglieder der Gemeinde sich gar nicht kennen? Wie kann die Kirche auf die ihr so fernstehenden Kreise eine Wirkung ausüben, wenn jede Bekanntschaft, jeder Verkehr mit denselben fehlt? Es geht ein tiefer Riß durch die ganze bürgerliche Gesellschaft: die Menschen verstehen sich nicht, weil sie sich nicht kennen. Wie auf sonstigen Gebieten zu helfen ist, ist eine der schwierigsten Fragen; auf kirchlichem Gebiete aber dürfen wir mit Bestimmtheit hoffen und aussprechen: Der erste Schritt, um große Massen der Kirche fernstehender Gemeindemitglieder heranzuziehen, besteht darin, daß die verschiedenen Kreise sich kennen und achten lernen, miteinander verkehren auf dem Gebiete gemeinsamer Arbeit für die Armen, Kranken und Schwachen. Für all diese Zwecke bedarf es aber eines lokalen Mittelpunktes innerhalb der Gemeinde. Das soll das Gemeindehaus sein.“36
In diesen Worten spiegelt sich wieder, was Theodor Knolle, Hauptpastor an St. Petri, später einmal als notwendige Orientierung auf die sich nach einer „sichtbaren Gemeinschaft“ sehnenden Menschen durch die „Bildung übersehbarer Gemeinden“ bezeichnete.37 Die Gemeindehäuser als Innovation des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren dabei die „baukonzeptionelle Antwort auf die Ausdifferenzierung der volkskirchlichen Struktur in Richtung auf gruppenspezifische Formen der sogenannten ‚Gemeindearbeit’, wie dies in einem jüngeren Aufsatz der Zeitschrift „Pastoraltheologie“ zu lesen ist.38 Aber nicht nur die Binnenverständigung innerhalb der Gemeinde sollte befördert werden, sondern eben auch die Außendarstellung mittels eines attraktiven Treffpunkts mit einer breiten, karitativen und sonstigen Angebotspalette. Es ging also um die Schaffung eines bis Ende des 19. Jahrhunderts kaum vorhandenen Gemeindelebens im breiteren kulturellen Sinne ebenso wie um die Neugewinnung und Aktivierung noch fern stehender Schichten wie z.B. weiter Kreise der Arbeiterschaft. Und dies in einer Situation, in der letztere Gruppe sich gerade anschickte, jenseits von Kirche und bürgerlich-kapitalistischem Staat eine andere, alternative Lebens- und Kulturauffassung auszuprägen.
In St. Georg musste ein solches kirchliches Konzept auf besondere Resonanz stoßen, war dieser Stadtteil doch, wie eingangs erwähnt, nachgerade zu einem Großstadtmoloch geworden, ein Durchgangsort, in dem damals angeblich jedes Jahr rund 30 % der Bewohnerschaft wechselten.39 Wie brach sich nun dieser Gedanke, die Gemeinde quasi neu zu konstituieren und dafür ein Gemeindehaus zu schaffen, Bahn? Welche Antwort konnte damit in einer Zeit gefunden werden, in der in St. Georg „eine völlig neue Menschenmasse angesiedelt wurde, (...) in der aus der Vorstadt die steinerne Großstadt wurde, in einer Zeit, wo die Lehre materialistischer Weltanschauung kulminierte und auch äusserlich im neuen Gewerkschaftshaus ihr mächtiges Bollwerk errichtete (...)“, wie das Dr. Erich Kappesser in einem Vortrag zum 25jährigen Bestehen des Gemeindehauses Anfang 1933 ausdrückte?40
Die Idee zu einem St. Georger Gemeindehaus stammte offenbar von Alfred Kappesser (1869-1932), dem Vater von Erich Kappesser; er hatte sie offenbar schon im November 1901 erstmals geäußert. Alfred Kappesser war nur wenige Monate zuvor aus Dithmarschen gekommen und als dritter Pastor in der Dreieinigkeitskirche tätig geworden.41 Auf die Initiative dieses jungen Mannes hin traf sich am 9. Februar 1903 ein Kreis von zehn Männern im Haus der Patriotischen Gesellschaft, um einen „Verein zur Erbauung des Gemeindehauses“ aus der Taufe zu heben.42 Die beiden Pastorenkollegen Kappessers – Detmer senior und Detmer junior – waren zwar eingeladen, aber nicht erschienen, was von gewissen Widersprüchen zwischen ihnen zeugt. Die dritte Vereinsversammlung am 19. Mai 1903 wählte dennoch Alexander Detmer zum Ehrenvorsitzenden, Richard Hempell zum 1. und Arthur F. Röding zum 2. Vorsitzenden, Dr. Bruno Meyer zum 1. und Julius Faulwasser zum 2. Schriftführer, Otto G. Miehe zum 1. und Alfred Kappesser zum 2. Rechnungsführer und Pastor Oskar Detmer in den erweiterten Vorstand. Die Detmers blieben nicht nur der Gründungsversammlung, sondern auch den weiteren Sitzungen fern, erklärten sich aber bereit, dass ihre Namen für den Vorstand benannt werden durften. Mitte Mai 1903 zog der alte Pastor Detmer allerdings auch diese Zusage zurück und charakterisierte den Verein als „trennende“ und ausdrücklich „gegen seinen Wunsch und Willen“ gerichtete Unternehmung.43 Ob sich hierin nur die Vorbehalte eines gealterten Herrn gegenüber der außerordentlich dynamisch auftretenden Nachwuchskraft niederschlagen, mag dahin gestellt sein.
Beim Vergleich der Anwesenden (und Entschuldigten) auf dem Gründungstreffen 1903 und der Zusammensetzung des späteren Kirchenvorstandes von 1906 fällt jedenfalls auf, dass kein einziger identischer Name auftaucht. Es kann daher angenommen werden, dass sich der Gemeindehaus-Verein anfangs eher aus einer anderen, womöglich der „positiven“ Richtung rekrutierte, als der Kirchenvorstand, der ja „liberal“ besetzt war. Dies wäre jedenfalls z.T. eine Erklärung dafür, warum der Verein „St. Georger Gemeindehaus e.V.“ sich de jure unabhängig konstituierte und letztlich erst 1946 das Gemeindehaus der Kirchengemeinde übertrug. Die hier gemutmaßten Konflikte spielten jedoch nur in der allerersten Phase eine Rolle, später sind auch verschiedene Kirchenvorstandsmitglieder in die Gemeindehausentwicklung involviert. Schon auf der zweiten Vereinszusammenkunft am 16. Februar 1903 kamen erste Grundstücke ins Gespräch: das Bohlen’sche Haus beim Strohhaus, und ein Gebäude in der Böckmannstraße 54. Ersteres Objekt war für 50.000 Mark zu haben, aber wurde als zu peripher gelegen abgelehnt; zweiteres war mit 40.000 Mark zwar günstiger, aber eben auch kleiner, dafür hatte es eine zentrale Lage.
Doch diese Vorschläge versandeten, so dass sich die Debatte allgemein um die Frage der konkreten Ausgestaltung und Nutzung des projektierten Gebäudes drehte. Die Kapitaldecke war von Anfang vergleichsweise gut, weil es Kappesser schon im Juni 1902 – noch nicht einmal ein Jahr in St. Georg – gelungen war, Lutherfestspiele im Deutschen Schauspielhaus durchzuführen und den Reinerlös von ca. 20.000 Mark „zum Besten der Erbauung eines Gemeindehauses der St. Georger Kirche“ zurückzulegen. Über 300 „Damen und Herren aus allen Kreisen der Gesellschaft“ nebst bekannten SchauspielerInnen wie Robert Nhil und Elisabeth Hruby beteiligten sich an den insgesamt sechs Aufführungen, die unter der Leitung von Ludwig Max auf die Bühne gebracht wurden.44 Unter der Ägide des mittlerweile konstituierten Vereins folgte im Februar 1904 ein dreitägiger Basar mit abschließendem orientalischen Fest in den berühmten Sagebiel’schen Sälen, an dem sich rund 100 Firmen und mehrere Hundert Aktive beteiligten.45 Er brachte nochmals ca. 20.000 Mark für den Baufonds ein. Durch weitere Spenden, Haussammlungen, Vortragsveranstaltungen von Kappesser und des Künstlers Ludwig Max konnte das Vereinsvermögen bis 1906 auf 100.000 Mark aufgestockt werden. Immerhin 691,48 Mark steuerte im Dezember 1905 auch der noch heute existierende Bürgerverein von 1880 bei, eine Summe, die aus einer von ihm veranstalteten Verlosung zu Gunsten des Gemeindehauses stammten. Die letztlich noch fehlende, durchaus erkleckliche Summe kam dann noch von der Hamburger Sparkasse von 1827.
Im Archiv der Gemeinde findet sich ein Spendenaufruf des Vereins vom Mai 1903. Darin wurde zum ersten Mal öffentlich gemacht, welche Ziele er verfolgte. Gleich zu Anfang des Textes wird auf die „Gemeindepflege St. Georg“ und deren Raumbedarfe hingewiesen. Diese Einrichtung der Kirchengemeinde war von Pastor Alexander Detmer zum 1. Oktober 1887 ins Leben gerufen worden, um in bescheidenem Maße die Armen- und Krankenpflege zu betreiben. Diesbezüglich hatten in St. Georg Amalie Sieveking mit ihrem 1832 gegründeten „Weiblichen Verein für Armen- und Krankenpflege“ und Elise Averdieck (1808-1907) mit der Diakonissenanstalt „Bethesda“ von 1856 schon die entscheidenden Impulse geliefert.46 Die in der Gemeindepflege tätigen Schwestern waren zunächst unter äußerst beengten Verhältnissen in der Bleicherstraße (der heutigen Schmilinskystraße) untergekommen und 1902 in nicht eben üppigere Räume in der Langen Reihe 92 umgezogen. Dieser Gemeindepflege angemessene Räumlichkeiten mit verschiedenen Angeboten und Publikumsverkehr zu schaffen, war von Anbeginn ein erklärtes Ziel des Gemeindehaus-Vereins.47 Auch die Gemeindepflege trug später mit rund 22.000 Euro maßgeblich zum Bau des Gemeindehauses bei.48
Zitieren wir eine längere Passage aus dem besagten Spendenaufruf des Gemeindehaus-Vorstandes vom Mai 1903. „Die unter dem Namen Gemeindepflege der St. Georger Kirche zusammengefassten Bestrebungen haben mit der Zeit einen derartigen Umfang gewonnen, daß für die weitere Entwickelung ein eigenes Heim zum dringenden Bedürfnis geworden ist. Zu der gut organisierten Armenpflege ist die Fürsorge für die heranwachsende Jugend gekommen. Dahin gehören u.A. der Kindergottesdienst, die Nähschule, der Lehrlingsverein und die Sammlung konfirmirter Mädchen. Zur Pflege edler Volksmusik besteht ein dreistimmiger Frauenchor, der demnächst zu einem gemischten Chor erweitert wird. Zur geistigen Anregung dient ferner eine im Sinne der öffentlichen Bücherhallen eingerichtete Bibliothek, die bei ca. 1000 Bänden gut gewählter Literatur durch freiwillige Kräfte täglich dem Publikum vermittelt wird. Endlich werden Bibelstunden und Vortragsabende veranstaltet. Und andere wichtige Aufgaben harren der Erledigung, so daß der Mangel eines geräumigen Gemeindehauses als ein großer Notstand empfunden wird.“ Dieser Aufruf wurde übrigens auch von vielen Kirchenvorstandsmitgliedern sowie Bürgervereinsvertretern unterzeichnet.49
Anfang 1905 hatte der Vereinsvorstand endlich auch ein geeignet erscheinendes Grundstück ausfindig gemacht, nämlich eine 926 Quadratmeter große, noch unbebaute Fläche an der Ecke Rostocker/Stiftstraße. Da es sich dabei um ein dem Hamburger Staate gehörendes Grundstück handelte, waren längere Verhandlungen nötig. Eine eigens eingesetzte Bürgerschaftskommission beriet das Thema abschließend erst Ende 1905. Es gab Kontroversen u.a. um die Frage, ob das Grundstück nicht möglicherweise für die Erweiterung der benachbarten Volksschule – sie ist aktuell im Gespräch, weil die stadteigene Sprinkenhof-AG das Gebäude, gegen den Widerstand aus dem Stadtteil, im Höchstgebotsverfahren verkaufen will – frei gehalten werden sollte. Letztlich empfahl der Ausschuss dem Senat aber mit Mehrheit, dem Verein das Grundstück in Erbbaupacht für 80 Jahre zu überlassen.50 Der entsprechende Vertrag konnte mit der Finanzdeputation schließlich am 7. März 1906 abgeschlossen werden. Ein Bauausschuss wurde gebildet, dem neben Kappesser, August Doss, Gustav Gramcko und Arthur F. Röding auch Julius Faulwasser (1855-1944) angehörte. Letzterer sollte zum Architekten des neuen Gemeindehauses werden. Der zur backsteinverliebten Hannoverschen Schule zu zählende Baumeister war langjähriger St. Georger und hat nicht nur ein grundlegendes Buch über die Dreieinigkeitskirche verfasst,51 sondern auch einige Gebäude der Amalie Sieveking-Stiftung sowie Kirchenbauten in der Stadt entworfen.52 Der erste Spatenstich zum Gemeindehaus erfolgte schließlich am 3. August 1906, die Erstbelegung dann im Juni 1907.53 Rund 180.000 Mark mussten letztlich aufgebracht werden,54 eine Dimension, die den Gemeindehaus-Vorstand noch lange über den Bau hinaus beschäftigte.
Die Einweihungsfeier für das neue Gebäude an der Stiftstraße 15/17 fand am 8. September 2007 im großen Versammlungssaal des Gemeindehauses statt. Er fasste nach seiner Fertigstellung ca. 350 Personen, hatte Garderobenräume und eine kleine Teeküche. Neben den obligatorischen musikalischen Beiträgen hielten die Reden Senator Sander, Senior Behrmann, Alfred Kappesser und – Oskar Detmer.55
Einer Beschreibung von Anfang 1933 entnehmen wir, in welcher Weise das Gemeindehaus ab 1907 genutzt wurde: „In dem geräumigen Keller hatte die Patriotische Gesellschaft ihre Zentrale für Säuglingsmilch-Bereitung, und eine Haushaltungsschule bezog die modernen Lehrküchen. Der große Saal (jetzt Luthersaal) mit einem Steinway-Flügel
der Gemeindepflege Raum; in einem Sprechzimmer und geräumigen Vorstandszimmer wurde die Verwaltungsarbeit erledigt. Bei späterem Platzmangel diente das letztere dem Jungmädchen-Bund als Heim. Im II. Stock fand die große Schwestern-Station mit 8 stationierten Zehlendorfer Diakonie-Schwestern ihr gemütliches Heim, und schließlich birgt das Haus 13 Wohnungen für alleinstehende Damen.“56
Rund 100.000 – sicher mehrfach gezählte – BesucherInnen soll das Gemeindehaus im Winter 1908/1909 aufgenommen haben, „ohne die Besucher fremder Saalveranstaltungen. Damit war das Haus ständig voll“, erinnerte sich Erich Kappesser knapp zweieinhalb Jahrzehnte später.57 Das Konzept schien also aufgegangen zu sein, gemessen an den folgenden Jahresberichten u.a. der Gemeindepflege kristallisierte sich das Gemeindehaus tatsächlich als neuer Mittelpunkt der St. Georger ev.-luth. Christen heraus. Und nicht nur das, denn auch z.B. der „Arbeiter-Schachverein Gross-Hamburg“ – eine der Kulturorganisationen der Arbeiterbewegung – überwand alle Gräben und siedelte um 1921 seine „Zentralabteilung“ für den Großraum Hamburg ausgerechnet im Gemeindehaus an.58
Ganz geheuer aber blieb den Gemeinde(haus)vertretern die Umgebung nicht, denn gleich gegenüber erstreckte sich der ehemalige Grützmachergang (parallel zur heutigen Revaler Straße), die Hochburg der kommunistischen Arbeiterschaft noch bis 1933. Auf einen Antrag der Frauenschaft der NSDAP von Ende 1932, einen Saal im Gemeindehaus für die Durchführung von Nähabenden zu mieten, reagierte der Vorstand im Grunde ablehnend, da man es – allemal in so brisanten Zeiten – vermeiden wolle, irgendeine Verbindung zu einer politischen Partei herzustellen. „Unser Haus“, heißt es in dem Antwortschreiben vom 8. Dezember 1932, „liegt insofern besonders unglücklich, als es von einer rein kommunistischen Wohnbevölkerung umgeben wird und die Gefahr von Unzuträglichkeiten dadurch besonders groß ist.“ Aber in diesem Falle wolle man die Nutzung dennoch akzeptieren, sofern auf alle politischen Bekundungen und Fahnen etc. verzichtet würde.59 Ein halbes Jahr später, auf einer Gemeindehaus Vorstandssitzung am 10. Mai 1933, wurde unter Tagesordnungspunkt 5 lapidar beschlossen, „dass gegen die Vermietung von Räumen an politische Verbände und Parteien keine Bedenken mehr erhoben werden.“60 Es gab ja auch nur noch die NS-Organisationen.
So entwickelte sich das Gemeindehaus ab 1907 mitten in einer von der Arbeiterschaft bewohnten Umgegend und dürfte damit seinen durchaus beabsichtigten Einfluss ausgeübt haben. Die Auswahl des Standortes fernab der Dreieinigkeitskirche – mehr oder weniger in gleicher Distanz zur abtrünnigen Stiftskirchengemeinde in der Stiftstraße – dürfte dennoch vor allem dem Zufall eines geeignet erscheinenden und zur Verfügung stehenden Grundstücks gezollt gewesen sein. Von der Stadt (!) wurde 1920 beim Oberbaudirektor Fritz Schumacher der Entwurf eines Pfarr- und Gemeindehauses auf dem (heutigen Spielplatz) St. Georgs Kirchhof in Auftrag gegeben.61 Ob damit ggfs. verbunden war, das Grundstück an der Rostocker/Stiftstraße zurückzuverlangen und z.B. für einen Schulausbau zu nutzen, ist unklar; eine Antwort auf diese Frage bleibt der weiteren Forschung vorbehalten. Die Pläne wurden damals jedenfalls verworfen.
Michael Joho
Sieveking, Amalie: Zweites Sendschreiben der Vorsteherin des weiblichen Vereins für Armen- und Krankenpflege an ihre Freunde unter den Armen. Hamburg 1848. S. 17.
Wischermann, Clemens: Wohnen in Hamburg vor dem Ersten Weltkrieg. Münster 1983. S. 438.
Ebenda.
Ebenda.
Joho, Michael: „Dies Haus soll unsere geistige Waffenschmiede sein“ (August Bebel). 100 Jahre Hamburger Gewerkschaftshaus 1906-2006. Hamburg 2006. S. 13ff.
Hennig, Martin: Beiträge zur nordelbischen und zur hamburgischen Kirchengeschichte. Breklum 1988. S. 61.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 4 (1907) 16, vom 21.4.1907. S. 126.
Overlack, Victoria: Zwischen nationalem Aufbruch und Nischenexistenz. Evangelisches Leben in Hamburg 1933-1945. Hamburg 2007. S. 38.
Melhop, Wilhelm: Historische Topographie der Freien und Hansestadt Hamburg von 1895-1920. Mit Nachträgen bis 1923. I. Bd. Hamburg 1923. S. 177f.
Henning 1988, a.a.O., S. 37.
Jensen, Wilhelm (Hrsg.): Die hamburgische Kirche und ihre Geistlichen seit der Reformation. Hamburg 1958. S. 195f.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 1 (1904) 4, vom 24.4.1904. S. 30.
Severin, Günther: Jahre einer Gemeinde. Eilbek 1872-1943. Hamburg 1985. S. 48.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 1 (1904)vom 15.7.1904. S. 129.
Jensen 1958, a.a.O., S. 197.
Gottwald, Herbert/Herz, Heinz: Deutscher Protestantenverein (DPV) 1863-1945. In: Lexikon zur Parteiengeschichte. In vier Bänden. Bd. 2. Hrsg. von Dieter Fricke u.a. Köln 1984. S. 251-257.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 1 (1904) 11, vom 12.6.1904. S. 92.
Joho, Michael (Hrsg.): St. Georg lebt! 125 Jahre Bürgerverein St. Georg – ein Lese-Bilder-Buch. Hamburg 2005. S. 13ff.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 3 (1906) 47, vom 18.11.1906. S. 385.
Ebenda, S. 386.
Joho 2006, a.a.O., S. 34.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 4 (1907) 15, vom 14.4.1907. S. 114.
Hering, Rainer: Vom Seminar zur Universität. Die Religionslehrerausbildung in Hamburg zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik. Hamburg 1997. S. 23.
Overlack 2007, a.a.O., S. 39.
Joho, Michael: Vor 80 Jahren: Einweihung der ersten, vereinseigenen Turnhalle des Hamburger Arbeitersports. In: Sozial- und Zeitgeschichte des Sports, Aachen, 7 (1993) 3. S. 7-28.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 4 (1907) 20, vom 19.5.1907. S. 157.
Gottwald, Herbert: Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands (GCG) 1901-1933. In: Lexikon zur Parteiengeschichte. In vier Bänden. Bd. 2. Hrsg. von Dieter Fricke u.a. Köln 1984. S. 729-768.
Ruck, Michael: Gewerkschaften – Staat – Unternehmer. Die Gewerkschaften im sozialen und politischen Kräftefeld 1914 bis 1933. Köln 1990. S. 203.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 4 (1907) 7, vom 17.2.1907. S. 54.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 3 (1906) 16, vom 15.4.1906. S. 129.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 3 (1906) 8, vom 18.2.1906. S. 61.
Classen, Walther: Sechzehn Jahre im Arbeiterquartier. Hamburg 1932. S. 16.
Ebenda, S. 146.
Möller, J.: Das evangelische Gemeindehaus. Berlin 1928. S. 3ff.
Schäfer, Theodor: Die Bedeutung des Gemeindehauses. In: Das Gemeindehaus. Hrsg. von P. Cremer. Potsdam 1905. S. 1.
Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 5 (1908) 20, vom 17.5.1908. S. 157.
Knolle, Theodor: Kirchliche Chronik. In: Hamburger Kirchenkalender 1933. Jahrbuch für die Hamburgischen Gemeinden. Hrsg. von Heinz Beckmann und Theodor Knolle. Hamburg 1932. S. 122.
Wendland, Gerhard: Gotteshaus und Gemeindehaus – ein Plädoyer für die offene Kirchentür. In: Pastoraltheologie, Göttingen, 86 (1997). S. 363.
Kappesser, Erich: Festrede, gehalten zur Feier des Dreißigjährigen Bestehens des Vereins zur Errichtung eines Gemeindehauses und Fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Gemeindehauses am Sonntag, den 12. Februar 1933. Hamburg 1933 (Abschrift von Harald Riege 2007). S. 4.
Ebenda, S. 7f.
Jensen 1958, a.a.O., S. 196f.
Wenn nichts anders angegeben, sind die Informationen dem ersten Protokollbuch über die Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen des Vereins St. Georger Gemeindehaus e.V. entnommen, zu finden im Archiv der Kirchengemeinde St. Georg, Nr. 104.
Alfred Detmer an Erich Kappesser vom 17.5.1903. In: Kirchenarchiv St. Georg, Nr. 495.
Lutherfestspiel im Deutschen Schauspielhaus zu Hamburg am 3., 4., 5., 6., 7., 8. Juni 1902. Luther, historisches Charakterbild in 7 Abtheilungen, von Dr. Otto Devrient. Hamburg 1902 (Programm).
Kappesser 1933, a.a.O., S. 11f.
Joho, Michael: Alt genug für neue Wege. 175 Jahre Amalie Sieveking-Stiftung. Hamburg 2007. S. 34.
25 Jahre St. Georger Gemeindehaus 1907-1932. Hamburg 1933 (im Anhang zu: Kappesser 1933, a.a.O., S. 17.
20. Jahresbericht der Gemeindepflege zu St. Georg über das Jahr 1907. Hamburg, im März 1908. S. 3.
Der Aufruf findet sich im Kirchenarchiv St. Georg unter der Signatur 182.
Bericht des von der Bürgerschaft am 5. Juli 1905 niedergesetzten Ausschusses zur Prüfung des Antrags des Senats (Nr. 124) betreffend Überlassung eines Platzes an der Rostockerstraße für ein Gemeindehaus der St. Georger Kirche. Drucksache Nr. 59, vom Dezember 1905. In: Kirchenarchiv St. Georg, Nr. 495.
Faulwasser, Julius: Die Heilige Dreieinigkeits-Kirche genannt die St. Georger Kirche in Hamburg. Hamburg 1928.
Faulwasser, Julius: Kirchliche Bauten. In: Hamburgisches Kirchenblatt, Hamburg, 3 (1906) 37, vom 9.9.1906. S. 302.
Kappesser 1933, a.a.O., 11f.
Faulwasser 1928, a.a.O., S. 53.
25 Jahre St. Georger Gemeindehaus 1907-1932. Hamburg 1933 (im Anhang zu: Kappesser 1933, a.a.O., S. 17.
Ebenda.
Kappesser 1933, a.a.O., S. 12.
Festschrift der ersten Reichs-Arbeiter-Sportwoche des Kartells für Arbeiterbildung Sport und Körperpflege Groß-Hamburg. Vom 28. Mai bis 5. Juni 1921. Hamburg 1921. S. 130.
Schreiben des Gemeindehaus-Vorstandes an die Frauenschaft der NSDAP vom 8.12.1932. In: Kirchenarchiv St. Georg, Nr. 182.
Vorstandsprotokoll vom 10.5.1933. In: Kirchenarchiv St. Georg, Nr. 496.
61 Frank, Hartmut (Hrsg.): Fritz Schumacher. Reformkultur und Moderne. Hamburg 1994. S. 261.
Von Michael Joho
Das Jahr 1906 war zweifellos eines der bewegtesten in der Hamburger Geschichte. Mit einem politischen Knall war es in der Stadt gleich am 17.1.1906 los gegangen, fand an diesem Tag doch der erste politische Generalstreik Deutschlands statt. Er richtete sich gegen den „Wahlrechtsraub“, d. h. gegen den Ausschluss von Kleinverdienern, also vor allem der sozialdemokratisch eingestellten Arbeiterklasse von politischen Wahlentscheidungen. So ganz anders motiviert war am 2.6.1906 die Enthüllung des Bismarck-Denkmals an der Helgoländer Allee, und wieder ganz anders die Einweihung der Synagoge am Bornplatz am 13.9. Es folgten am 5.12. die Eröffnung des Hauptbahnhofs an der Kirchenallee mit seiner damals größten Bahnhofshalle in Deutschland und als glorreicher Abschluss die Einweihung des Gewerkschaftshauses am Besenbinderhof am 29.12.1906.
Schon seit 1894 hatten die Gewerkschaften Überlegungen getätigt, für ihre im Anwachsen begriffenen rund 36.700 Mitglieder (1900) Verwaltungsbüros zu schaffen. Ebenso bedurfte es aber auch großer Versammlungssäle und nicht zuletzt einer Herberge für die ca. 10.000 reisenden Gesellen und Arbeiter (1893), die als Organisierte Anspruch auf Unterstützung hatten. Aber erst 1904 wurde es Ernst: Der Gründung einer Gewerkschaftshaus Hamburg GmbH folgte der Ankauf eines Geländes am Besenbinderhof. Mitbeteiligt waren die Konsum-, Bau- und Sparvereinigung „Produktion“ und die SPD, vor allem deren I. Wahlkreis, in dessen Einzugsgebiet das Gewerkschaftshaus dann innerhalb von 15 Monaten errichtet wurde. Die Einweihungsrede hielt der Führer der Sozialdemokratie, August Bebel (1840-1913), der über Hamburgs I. Wahlkreis ab 1883 fast durchgängig bis zu seinem Tod in den Reichstag gewählt wurde. Von ihm stammt das geflügelt Wort von der „geistigen Waffenschmiede, wo nicht nur die Kämpfe zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter beschlossen, sondern auch die Kriegspläne beraten werden, wie dem Proletariat dauerhaft geholfen werden kann“.
Binnen kürzester Zeit entwickelte sich das Gewerkschaftshaus zum Zentrum längst nicht nur der hamburgischen Arbeiterbewegung: Hier wurde 1907 der örtliche Arbeitersamariterbund konstituiert, 1918 quartierte sich kurzfristig der Arbeiter- und Soldatenrat ein, 1919 tagte die Gründungsversammlung der Volksbühne, 1923 die der Sozialistischen Arbeiterinternationale, auf dem ADGB-Bundeskongress. 1928 stellte Fritz Naphtali (1880-1961) das für die deutschen Gewerkschaften so wichtige Konzept der „Wirtschaftsdemokratie“ vor. Noch wichtiger für die Hamburger Arbeiterschaft war sicherlich, einen Treffpunkt zu haben, zu dem die GenossInnen strömten, wenn es irgendwo in der Stadt politisch brannte. 5 bis 8000 Menschen fanden im Haus Platz, und reichte der nicht, versammelten sich die Übrigen auf dem Besenbinderhof.
Am 2.5.1933 machten de Nazis Schluss damit. Tags zuvor hatten sie noch zur Teilnahme an ihrer „Maifeier“ im Stadtpark aufgerufen, unterstützt vom ADGB, der sich durch seine Anbiederung das Überleben der Organisationen erhoffte. Doch am 2. Mai stürmten SA und SS das Gewerkschaftshaus, nahmen die Funktionäre fest, verbrannten erst die alten Traditionsfahnen, später auch Teile der wertvollen Gewerkschaftsbibliothek. Für 12 Jahre wurde aus dem Gewerkschaftshaus nun das „Haus der Arbeit“, geführt von der „Deutschen Arbeitsfront“, die sich sämtliche Besitztümer der Gewerkschaften und deren Mitglieder einverleibte.
Als am 8.5.1945 in der Welt gerade die Befreiung vom Nationalsozialismus gefeiert wurde, saßen die überlebenden Antifaschisten aus SPD, KPD und kleineren Gruppierungen schon wieder im Gewerkschaftshaus. Hier gründeten sie auch offiziell am 11.5. die „Sozialistische Freie Gewerkschaft“ – eine Antifa-Organisation der ersten Wochen, die eine Verknüpfung von gewerkschaftlicher und politischer Arbeit anstrebte – und davon ausging, nun auf den Trümmern der alten eine neue sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Doch ältere Funktionäre aus der Zeit der Weimarer Republik setzten bald wieder auf die Branchengewerkschaften, deren Zusammenschluss dann 1949 im DGB mündete. Wenn das Gewerkschaftshaus z.T. auch bereits ab dem 14.9.1945 den KollegInnen wieder zur Verfügung stand, nicht ohne dass an diesem Tag das DAF-Symbol (ein Hakenkreuz im Zahnrad) durch den Baugewerkschafter Paul Bebert (1893-1976) abgeschlagen worden wäre, sollte sich die Rückübertragung aus dem Zugriff der britischen Besatungsmacht noch bis 1949 verzögern.
In den darauf folgenden Jahrzehnten wurde das Gewerkschaftshaus wieder zur Organisations- und zum Anlaufpunkt der meisten Hamburger Verbände, zuletzt beim Ver.di- Streik im Frühjahr 2006, als sich hier jeden Morgen Hunderte StreikaktivistInnen trafen, um die Aktionen für den Tag zu beraten. Auch die Maidemonstrationen fanden auf dem Besenbinderhof oftmals ihren Auftakt oder Abschluss. Noch einmal besetzt wurde das Gewerkschaftshaus am 4.5.1980. Dieses Mal waren es allerdings 3 bis 4000 GewerkschafterInnen, die durch ihre Präsenz eine Veranstaltung der rechtsextremistischen DVU in der Gaststätte des Hauses verhinderten.
In jüngster Vergangenheit stellt sich das Gewerkschaftshaus nicht nur angestrahlt und generalüberholt dar. Die Ausstellungs- und Veranstaltungshäufigkeit hat spürbar zugenommen, das Foyer wurde auf Vordermann gebracht, und zur Jahreswende 2005/06 ist ein Kulturverein Gewerkschaftshaus ins Leben gerufen worden, der mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Konzerten und sonstigen Aufführungen lockt. Dass sich zudem „das Gewerkschaftshaus“ und seine MitarbeiterInnen weiterhin um Fragen der Interessenvertretung, Rechtshilfe, Bildungsangebote, Frauen- und Tarifpolitik etc. kümmern, liegt auf der Hand. Wozu u.a. die Mobilisierung von allein 2000 KollegInnen für die Teilnahme an der Berliner DGB-Großdemonstration gegen die „Gesundheitsreformen“ usw. zählte.
Es tut sich also wieder etwas am Besenbinderhof!
(Dezember 2006)
Buchbeitrag von Michael Joho
erschienen in »Hamburg: Gespaltene Stadt? Soziale Entwicklungen in der Metropole«
Hrsg. von Gerd Pohl und Klaus Wicher. Hamburg 2013. S. 158 - 181
Buchbeitrag von Michael Joho
erschienen in »Lebenswertes Hamburg. Eine attraktive und soziale Stadt für alle?«
Hrsg. von Gerd Pohl und Klaus Wicher. Hamburg 2019. S. 145 - 164.
Stadtteile St. Georg und Hammerbrook in der NS-Zeit
von Michael Joho
„Naziviertel“ St. Georg?
„St. Georg, Hohenfelde und Eilbek haben sich in den letzten Wahlkämpfen unrühmlich ausgezeichnet“, hieß es im sozialdemokratischen „Hamburger Echo“ vom 13. Juli 1932. Diese Stadtteile „entlarven sich an ihren Flaggen und Wahlergebnissen als besondere Stützpunkte der nationalsozialistischen ,Arbeiterpartei‘.“ Vom „Naziviertel“ St. Georg war im damaligen Artikel die Rede, ein Stichwort, das in einem Flyer der Geschichtswerkstatt 1993 Verwendung fand und dazu führte, dass eben dieser Flyer nicht in die „Blätter aus St. Georg“ des „ Bürger vereins zu St. Georg von 1880 R. V.“ eingelegt werden durfte.
Arbeiterviertel St. Georg-Süd
Was hat es mit dieser Bezeichnung als „Naziviertel“ auf sich, das der Stadtteil angeblich schon vor 1933 gewesen sein soll, wobei die Zuschreibung noch Jahrzehnte später für Kontroversen sorgt? Zur Beurteilung dieser Frage ist zunächst eine Differenzierung dahingehend erforderlich, dass St. Georg vor einem dreiviertel Jahrhundert die späteren Stadtteile Hammerbrook, Klostertor und St. Georg umfasste. 1933 lebten allein in St. Georg-Nord – von den räumlichen Grenzen her nahezu identisch mit dem heutigen St. Georg – 34.403 Menschen, im damaligen St. Georg-Süd – also in Hammerbrook und Klostertor – sogar 52.197.[1] Wenn bisweilen in der Presse vom „alten Arbeiterviertel St. Georg“ die Rede ist, dann handelt es sich um ein Missverständnis. Ein weitgehend homogenes Proletariermilieu gab es nämlich nur im Hammerbrook, und der war per „Groß-Hamburg-Gesetz“ 1937/38 zu einem selbstständigen Stadtteil erhoben und 1943 im alliierten Bombenhagel und Feuersturm zu über 90 Prozent zerstört worden. Im Hammerbrook betrug der Anteil der Arbeiter und Arbeiterinnen 1925 genau 56,7 Prozent und lag damit um 12 Prozentpunkte über der Stadt (44,7 Prozent) und sogar um gut 20 Prozent höher als in St. Georg-Nord (36,5 Prozent).[2]
Der rote Hammerbrook
Hammerbrook wählte bis zum Verbot der Arbeiterparteien KPD und SPD 1933 zu fast zwei Dritteln rot, eine Haltung, die sich in der Nazi-Ära bei der einen oder anderen Scheinabstimmung in einem weit überdurchschnittlichen Anteil ungültiger Stimmen niederschlug. Bis zu 20 Prozent ungültige oder ablehnende Stimmen in bestimmten Quartieren bei der so genannten Reichstagswahl am 29. März 1936 rief die hamburgische Wohlfahrtsstelle auf den Plan. In einem „vertraulichen Dokument“ vom 7. April 1936 bewertete sie die Wahlergebnisse z. B. für das Straßenareal Hammerbrookstraße , Süderstraße , Idastraße, Nagelsweg wie folgt: „Bis heute wird von diesen Leuten alles negiert; Versammlungen besuchen sie grundsätzlich nicht. Die Leute müssten einzeln in den Wohnungen bearbeitet werden, und zwar möglichst von Leuten, die am besten selbst Arbeiter sind und die die plattdeutsche Mundart beherrschen, auch überzeugend reden können. Es müssen hier im Bezirk unbekannte Pg.s sein, also nicht bodenständige Männer, da deren Schwächen und ev. Fehler hier zu sehr bekannt sind.“ Für das Einzugsgebiet Friesenstraße , Thüringerstraße, Heidenkampsweg heißt es im gleichen Dokument: „In der Zusammenballung dieser fraglichen Arbeitermassen auf bestimmte Straßenzüge sowie in der Anwendung eines ungeschriebenen und falsch verstandenen Verpflichtungsgefühles des Zusammenstehens beruht m. E. diese gegenseitige Stützung des negativ zum Staat eingestellten Bevölkerungsteiles.“[3] Kurz und gut: Es waren die Arbeiter und Arbeiterinnen Hammerbrooks, Barmbeks, Rothenburgsorts usw., die noch Jahre nach der „nationalsozialistischen Revolution“ den neuen Machthabern skeptisch bis ablehnend gegenüber standen.
Das mittelständisch geprägte St. Georg-Nord
Ganz anders die Situation in St. Georg-Nord, dem heutigen St. Georg, auf das nachfolgend der Fokus gerichtet ist. Hier, insbesondere auf der Großen Allee (= Adenauerallee ), dem Steindamm , der Langen Reihe und rund um den Hansaplatz dominierten seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die mittelständischen Kreise: Handwerk er, Gewerbetreibende, Selbstständige. „Die Mieten sind ziemlich teuer, weil die Wohnungen im Zentrum der Stadt gelegen und für geschäftliche Zwecke besonders brauchbar sind (...) hier wohnt der Mittelstand“, heißt es in einer Dissertation von 1939 über die St. Georger Verhältnisse 1935.[4] Ein ausgesprochenes Arbeiterquartier erstreckte sich lediglich zwischen der Brennerstraße und der Rostocker Straße , wo auch der Grützmachergang verlief – etwa dem Verlauf der heutigen Revaler Straße entsprechend –, das Zentrum des kommunistischen Einflusses und zugleich der Prostitution. Laut Volkszählung 1925 betrug der Arbeiteranteil in St. Georg-Nord lediglich 36,5 Prozent (in Hamburg 44,7 Prozent) gegenüber überdurchschnittlichen 34,6 Prozent Angestellten[5] und besonders auffälligen 21,55 Prozent (in Hamburg 15,72 Prozent) Selbstständigen.[6]
Nazi-Hochburg St. Georg-Nord
Die Nazis hatten in diesem bürgerlich geprägten Milieu schon früh Fuß gefasst und unterhielten hier nach den Erinnerungen des NSDAP-Gauleiters von 1926 bis 1928, Albert Krebs, seit 1926 eine der lediglich sieben, durchgängig aktiven Bezirksgruppen.[7] Bereits bei der Reichstagswahl am 20. Mai 1928 schnitt die NSDAP in St. Georg-Nord mit 3,5 Prozent deutlich besser ab als in Hamburg mit 2,6 Prozent. Bei allen darauffolgenden Wahlen lag die NSDAP in St. Georg-Nord durchschnittlich um 6 bis 7 Prozent über deren Hamburger Stimmanteil und sogar um 12 bis 18 Prozent über dem im Hammerbrook. Dies meinte das „Hamburger Echo“, wenn es im Juli 1932 St. Georg-Nord als „Naziviertel“ charakterisierte.
St. Georger Straßenkämpfe 1932
In den Erinnerungen eines „alten Kämpfers“ der im Stadtteil agierenden „Marine-SA“ liest sich das so: „St. Georg ist eins der wenigen Gebiete, in denen sich Kommune, Eiserne Front und SA in fast gleicher Stärke und Aktivität einander gegenüberstehen. In dem Straßenviereck Lohmühlenstraße , Langereihe, Bahnhofsplatz und Große Allee liegen Sturmlokale und Kommunistenkneipen fast nebeneinander. Ungefähr alle 100 Meter weht eine andere Fahne, hat eine andere Weltanschauung ihre Festung. (...) Hier aber hat in den letzten Monaten des Jahres 1932 die NSDAP erfolgreich festen Fuß gewonnen und sich in langen Kämpfen eine Stellung verschafft, die man als Hochburg ansprechen kann. (...) So ist St. Georg wohl der einzige Stadtteil, in dem der Gegner, wenn er einen SA-Mann überfällt oder angreift, mit Sicherheit darauf rechnen kann, daß stehenden Fußes Gleiches mit Gleichem vergolten wird.“[8]
Nazi-Stimmen aus dem St. Georger Bürger tum
Der Zustrom zu den St. Georger Schlägertrupps der SA und SS speiste sich, wie überall, vor allem aus der seit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 1929 sprunghaft angewachsenen Gruppe der sozial und politisch zunehmend entwurzelten Erwerbslosen. Die überdurchschnittlich vielen Stimmen für die NSDAP kamen allerdings primär aus den klein- und großbürgerlichen Kreisen, die sich durch die Krise, massive Umsatzeinbußen und diverse Konkurse an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz gebracht sahen. „Auch die finanziell gutgestellten Leute am Hansaplatz bekamen die Krise zu spüren“, erinnerte sich der dort aufgewachsene Hermann Rabe, „sie konnten ihre großen Wohnungen mit vier bis fünf Zimmern nicht mehr finanzieren und mußten vermieten, oft an Prostituierte, die die Miete zahlen konnten.“[9] Ihre besten Ergebnisse konnten die Nazis gerade in den bürgerlich dominierten Wohn- und Geschäftsstraßen erzielen. So vereinte die NSDAP bereits bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 u. a. in den Wahlbüros Holzdamm 5, Lange Reihe 99 und 103 jeweils rund 50 Prozent der Stimmen auf sich.[10]
Der großbürgerliche Holzdamm und die Nazis
Gerade der Holzdamm spielte für die Nazis eine besondere Rolle, sei es, dass in der Nummer 46 gleich 1933 die örtliche NSDAP-Dienststelle unter ihrem Leiter, dem Pg. Heinz Morisse, eröffnet wurde, sei es, dass Hitler das Hotel „Atlantic“ – neben dem „Reichshof“ an der Kirchenallee – zu seinem bevorzugten Domizil in Hamburg machte. Das „Atlantic“ beherbergte schon seit den 1920er Jahren die „Klubräume“ des Hamburger „Nationalklubs von 1919“, eines Zusammenschlusses von ca. 400 bis 500 konservativen und reaktionären Vertretern aus Politik , Wirtschaft, Kultur und Militär . Diese, in der Weimarer Republik den Deutschnationalen nahe stehende Honoratiorenvereinigung rühmte sich später, der erste Herrenclub in Deutschland gewesen zu sein, vor dem Hitler sprechen durfte. Dies geschah am 28. Februar 1926, trotz öffentlichen Redeverbots, dem Hitler infolge des Putsches in München von 1923 noch unterlag. Zweieinhalb Stunden konnte Hitler das nationalsozialistische Programm darlegen, immer wieder unterbrochen von „Bravo!“-Rufen und „lebhaftem Beifall“, wie im stenographischen Bericht notiert ist. „Wenn man begriffen hat“, führte Hitler aus, „daß die Schicksalfrage darin besteht, daß der Marxismus gebrochen wird, dann muß auch jedes Mittel recht sein, das zum Erfolg führen kann. (...) Entscheiden muß der härtere Schädel, die größte Entschlossenheit und der größere Idealismus. (Stürmischer Beifall.).“[11] Als es am 3. März 1931 zu einer „Öffentlichen Kundgebung für Privat-Eigentum und Privat-Wirtschaft gegen den wirtschaftszerstörenden Marxismus“ bei „Sagebiel“ an der Drehbahn kam, prangten unter dem entsprechenden Aufruf neben der NSDAP, der DNVP und der DVP nicht zuletzt die Unterschriften des auch in St. Georg vertretenen Grundeigentümer-Vereins und des Centralausschusses Hamburgischer Bürger vereine.[12]
Hoffnung auf Ruhe, Ordnung und Arbeit
Aus der Sicht der einfachen, eher unpolitischen Leute, beschreibt eine gewisse Erika Möller (der Name der 1982 Interviewten wurde geändert) die Umbrüche 1932/33 folgendermaßen. „Ich war siebzehn Jahre alt, arbeitete als Verkäuferin in einem Gardinengeschäft, Danziger Straße . Da war jeden Abend Schlägerei, von den Parteien. Jeden Abend so um sechs ging es los. (...) So konnte man schon gar nicht mehr ruhig auf die Straße gehen. Als nun 33 kam, war das ja dann besser, es war alles ruhig. Und das fanden wir schön.“[13] So mag es vielen Anwohnern gegangen sein, zumindest denen, die sich von den Nazis eine Verbesserung ihrer Lage und einen Ausweg aus der Krise versprachen.
Auf diese Bewegung setzte spätestens Ende 1932 der größte Teil des St. Georger Bürger tums, und auch die beiden christlichen Kirche n suchten die Nähe zur NSDAP. Der am 30. Juni 1932 verstorbene Pastor der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Georg, Alfred Kappesser, ließ sich von SA-Männern im Sarg aus der Kirche tragen und im Braunhemd beerdigen.[14] Wohlgemerkt: Mitte 1932, also ein halbes Jahr vor der Machtübernahme auf Reichsebene! Der Vorstand des St. Georger Bürger vereins führte ohne Not im Februar 1933 eine Abstimmung durch, wer hinter dem Kabinett Hitler stehe – „Ergebnis alle bis auf 4 weisse Zettel“.[15] Wohlgemerkt: im Februar 1933, also einen Monat vor der Machtübernahme der Nazis in Hamburg! Wenige Wochen später (am 30. März 1933) sollte ein Vorstandsmitglied des St. Georger Bürger vereins eine maßgebliche Rolle beim Sturz der liberal-demokratischen Führung des Centralausschusses Hamburgischer Bürger vereine spielen.[16]
Und auch der oberste Vertreter der Hamburger Katholiken und Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Marien, Prälat Bernard Wintermann, stellte als Zentrums-Abgeordneter in der Hamburger Bürger schaft im Frühjahr 1933 den Antrag, in der NSDAP-Fraktion hospitieren zu dürfen.[17] Selbst eine sechsköpfige Gruppe um den Vorsitzenden des im Gewerkschaft shaus am Besenbinderhof residierenden Allgemeinen Deutschen Gewerkschaft s-Bundes, den Sozialdemokraten John Ehrenteit, begab sich noch im Mai 1933 (!) in ein Hospitantenverhältnis zur NSDAP- Bürger schaftsfraktion.[18]
Widerstand gegen den aufziehenden Faschismus
Widerstand gegen den terroristischen, antidemokratischen Kurs der Nazis war also nicht nur aus bürgerlicher Richtung kaum zu erwarten und hat es – abgesehen von einzelnen Stimmen – 1933 leider auch nicht gegeben. Widerstand im Stadtteil kam lediglich aus den Reihen der Gewerkschaft en und der Arbeiterparteien, wenn sie auch heillos zerstritten waren und sich gegenseitig bekämpften. Unmittelbar vor der schon stark von Terror geprägten Reichstagswahl am 5. März 1933 verteilten St. Georger Sozialdemokraten ein Flugblatt, in dem es hieß: „Wenn man Kindern Schießprügel in die Hand gibt, so gibt es Tote. Und die nationalsozialistische Soldatenspielerei hat mehr als ein Menschenleben auf dem Gewissen.“[19]
Erste Verfolgungswelle ab März 1933
Die weitere Geschichte des Jahres 1933 sei abschließend noch mit einigen St. Georger Ereignissen veranschaulicht. Nach dem Rücktritt der SPD-Senatoren und der Bildung eines NSDAP-geführten Senats Anfang März 1933 änderte sich das Straßenbild schlagartig. „Die Nazis triumphierten“, erinnerte sich Hermann Rabe. „Das konnte man am Schritt merken. Wenn die jetzt durch die Straßen gingen, dann knallten die mit den Hacken auf, so ungefähr, wir sind jetzt die Herren der Welt.“[20] Und das ließen sie die politischen Gegner spüren. Am Tag nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 hisste ein Sturmtrupp der Nazis erstmals Hakenkreuzfahnen auf dem Gewerkschaft shaus, am 13. März wurde das KPD-Verkehrslokal „Scheibel“ im Kirchenweg besetzt und das Gewerkschaft shaus durchsucht, am 28. März fand eine Großrazzia im Hammerbrook statt, politische Gegner aus St. Georg – allemal nach dem Verbot der Arbeiterparteien und Gewerkschaft en – wurden zu Dutzenden in so genannte Schutzhaft genommen.[21] Stellvertretend sei an den Bewohner der Hohen Straße 41 (= Ferdinand-Beit-Straße ), den Schlosser Dagobert Biermann erinnert, der als Kommunist jüdischer Abstammung ab Mai 1933 wegen der Herstellung illegaler Druckschriften für zwei Jahre inhaftiert worden war und nach weiterer Widerstandstätigkeit und erneuter Festnahme und Deportation am 22. Februar 1943 in Auschwitz ums Leben kam.[22] Doch auch andere Bevölkerungsgruppen fielen der massiven Verfolgung anheim; innerhalb der ersten vier Monate unter den Nazis, also zwischen März und Juni 1933, wurden in Hamburg beispielsweise mehr als doppelt so viele Prostituierte festgenommen, wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor (nämlich 2095 gegenüber 969).[23]
Verfolgungen in Schulen und Kultur
In der Heinrich-Wolgast-Schule fanden seit Frühjahr 1933 jeden Montag Flaggenparaden auf dem Schulhof statt, bei gleichzeitigem Absingen des Deutschland- und des Horst-Wessel-Liedes.[24] Der Jahresbericht 1933 des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg vermerkte für den Mai stolz: „Die Entfernung marxistischer Bilder und die Verbrennung volksverhetzender Bücher ist restlos durchgeführt. Das Personal hat von sich aus die Räume mit Bildern des Führers und der Nationalen Revolution geschmückt.“[25] Der nazistische Ungeist tobte sich am 30. Mai 1933 auch auf dem Lübeckertorfeld aus, wo im Rahmen einer zweiten, fast vergessenen Bücherverbrennung Angehörige der Hitler- Jugend und der Jugend des Deutsch-Nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes die Schriften demokratischer und marxistischer Autoren in Flammen aufgehen ließen.[26] Wenige Wochen später wurden Lehrer demokratischer Gesinnung und jüdischer Abstammung suspendiert, z. B. der führende Hamburger Gewerkschaft er und Leiter der Heinrich-Wolgast-Schule, Max Träger, sowie der beliebte Lehrer an der Klosterschule, Walter Emil Bacher – zusammen mit seiner Frau Clara wurde er 1942 nach Theresienstadt deportiert und wenig später in Auschwitz ermordet.[27]
Verfolgung von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Der Intendant des Schauspiel hauses seit Januar 1932, Karl Wüstenhagen, entließ in vorauseilendem Gehorsam schon im März 1933 alle Schauspiel er jüdischer Abstammung wie Arnold Marlé, Emil Stettner und Julius Kobler. Die jüdischen Bürger innen und Bürger wurden von Frühjahr 1933 an in besonderem Maße schikaniert und terrorisiert; sie hatten in St. Georg-Nord mit 408 Gemeindemitgliedern 1925 immerhin noch einen Bevölkerungsanteil von 1,08 Prozent ausgemacht. Bereits am 1. April 1933 fand der erste „Juden-Boykott“ statt. Der SA-Mob rottete sich auch auf dem Steindamm zusammen, um mittels antisemitischer Plakate und Schaufensterschmierereien „jüdische Gewerbetreibende“ zu diffamieren und die „deutschen Volksgenossen“ vom Kauf bei ihnen abzuhalten.[28]
St. Georg in der Nazi-Zeit
Dass „die Hitlerjahre in St. Georg leidlich zu ertragen waren“, wie der schon fast legendäre St. Georger Hans Ross 1980 meinte, weil „man sich gegenseitig doch von Jugend auf an kannte. Bis der grausame Krieg alles jäh beendete, was bis dahin gut bestanden hatte“,[29] ist und bleibt eine lieb gewonnene, gehegte und gepflegte Nachkriegsmär. Mit dem ehemaligen Naziviertel St. Georg bereits vor 1933 ist dieser Mythos jedenfalls nicht in Deckung zu bringen, schon gar nicht mit der Verfolgung von Hunderten von Menschen alleine in St. Georg-Nord und -Süd, von Andersdenkenden, von Juden und Jüdinnen, Prostituierten, Homosexuellen und anderen Opfern zwischen 1933 und 1945.
„Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“
Dies gilt es auch noch Jahrzehnte danach in Erinnerung zu rufen. Wir sollten nichts und niemanden vergessen und insbesondere die Namen der vielen Opfer bewahren, u. a. durch die Aktion „Stolpersteine“ und die Benennung eines St. Georger Weges nach dem jugendlichen NS-Gegner Helmuth Hübener (des Helmuth-Hübener-Gang es zwischen der Greifswalder Straße und dem Kirchenweg ). Wir sollten aber auch aufmerksam sein, was das Wiedererstarken von rechtsextremistischen Kräften und Ideen anbelangt und allem machtpolitisch motivierten Säbelgerassel und Kriegstreibereien nachdrücklich entgegentreten. Dies sind notwendige Lehren aus der schwärzesten Phase deutscher Geschichte und zugleich zentrale Grundlagen unseres Zusammenwirkens in St. Georg, über alle weltanschaulichen, religiösen und organisationspolitischen Unterschiede hinweg.
Text von Michael Joho in dem Buch von Benedikt Behrens: Stolpersteine in Hamburg-St. Georg. Biographische Spurensuche. Herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Hamburg 2009.
Anmerkungen
1 Statistisches Jahrbuch für die Freie und Hansestadt Hamburg 1935/36, Hamburg 1936, S. 10.
2 Joho, Michael (Hrsg.): „Kein Ort für anständige Leute“. Hamburg 1990, S. 54.
3 Dokument in: Staatsarchiv Hamburg, Bestand Sozialbehörde I, VG 30.70.
4 Radischat, Hans: Die Jugend kriminalität in den Hamburger Stadtteilen St. Georg, Hammerbrook und Rothenburgsort im Jahre 1935. Hansische Universität, Diss. 1939 (mschr.), S. 8.
5 Joho 1990, a.a.O., S. 54.
6 Statistische Mitteilungen über den hamburgischen Staat, Nr. 24. Hamburg 1930, S. 13.
7 Krebs, Albert: Tendenzen und Gestalten der NSDAP. Stuttgart 1959, S. 41.
8 Ehrenreich, Bernd: Marine-SA. Hamburg 1935, S. 104f.
9 Abgedr. in: Beck, Johannes, u.a. (Hrsg.): Terror und Hoffnung in Deutschland 1933–1945. Reinbek 1980, S. 194.
10 Statistische Mitteilungen über den hamburgischen Staat, Nr. 29. Hamburg 1932, S. 21.
11 Abgedr. in: Jochmann, Werner: Im Kampf um die Macht. Frankfurt a. M. 1960, S. 104.
12 Flugblatt in: Staatsarchiv Hamburg, Bestand 224-2, M 1931.16.
13 Abgedr. in: Brodersen, Ingke, u. a. (Hrsg.): 1933: Wie die Deutschen Hitler zur Macht verhalfen, Reinbek 1983, S. 86 u. 88.
14 Beck, a.a.O., S. 196. Zur zwiespältigen Rolle Alfred Kappessers s.: Joho, Michael: Gemeindehäuser contra Arbeiterbewegung ? Vortrag am 28.11.2008 aus Anlass des 100jährigen Bestehens des Gemeindehauses. Der Text findet sich auf der Website der Geschichtswerkstatt St. Georg e.V. unter www.gw-stgeorg.de.
15 Original der Aufzeichnung im Besitz des Autors.
16 Joho, Michael (Hrsg.): St. Georg lebt! 125 Jahre Bürger verein St. Georg – ein Lese-Bilder-Buch. Hamburg 2005, S. 69.
17 Wilken, Holger: Die katholische Gemeinde in Hamburg vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1963. Universität Hamburg, Phil. Diss. 1997, S. 226.
18 Joho, Michael: „Dies Haus soll unsere geistige Waffenschmiede sein“ (August Bebel). 100 Jahre Hamburger Gewerkschaft shaus 1906–2006. Hrsg. vom DGB Hamburg. Hamburg 2006, S. 93.
19 Flugblatt in: Gedenkstätte Ernst Thälmann, Ordner „SPD 1933“.
20 Interviewpassage, abgedr. in: Joho 1990, a.a.O., S. 72.
21 Ebenda, S. 72ff.
22 Joho, Michael: Im Gedenken an unsere jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen aus St. Georg, die von deutschen Faschisten bedrängt, verfolgt, deportiert und ermordet wurden. In: Gemeindebrief (der ev.-luth. Kirche ngemeinde St. Georg), vom April/Mai 1992, S. 7 f.
23 Biermann, Pieke: „Wir sind auch Frauen wie andere auch!“ Reinbek 1980, S. 84.
24 Joho 1990, a.a.O., S. 78.
25 Jahresbericht des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg für das Kalenderjahr 1933. Hamburg um 1934 (mschr.).
26 Schütt, Ernst Christian, u. a.: Die Chronik Hamburgs. Dortmund 1991, S. 457.
27 Brix, Barbara: „Land, mein Land, wie leb’ ich tief aus dir“. Dr. Walter Bacher – Jude, Sozialdemokrat, Lehrer, Lehrer an der Klosterschule. Hamburg 1997.
28 Joho 1992, a.a.O., S. 3ff.
29 Ross, Hans: Was mich mit St. Georg verbindet. In: Blätter aus St. Georg, Nr. 5/1980, S. 6.
